Promi-Unterschriften für Gaza: Kostet ja nix
Promis unterzeichnen gern offene Briefe. Dabei setzen sie auf Konsens statt Konfrontation. Geht es ihnen wirklich um Gaza oder um Selbstdarstellung?
A ls der britische Komiker Ricky Gervais 2020 die Golden-Globe-Verleihung moderierte, rief er zu Beginn erst mal alle anwesenden Prominenten im Saal zur Ordnung: „Wenn ihr heute Abend einen Preis gewinnt, benutzt ihn nicht als Plattform für eine politische Rede. Ihr seid in keiner Position, der Öffentlichkeit irgendetwas zu predigen. Ihr wisst nichts über die wirkliche Welt.“ Fünf Jahre sind seit diesem durchaus nicht nur als Gag zu lesenden Hinweis mittlerweile vergangen, aber Prominente predigen immer noch der Öffentlichkeit, als seien sie kollektiv in einen Zaubertrank voller Weisheit gefallen.
Am 31. Juli wurde ein sogenannter offener Brief an die Öffentlichkeit weitergeleitet, in dem sich zunächst mehr als 200 Schauspieler, Musiker, Moderatoren und Menschen mit einem verifizierten Instagram-Account zusammengetan hatten, um Friedrich Merz ihre Betroffenheit über den Gazakrieg mitzuteilen. Aber vor allem, um der Öffentlichkeit ihre moralische Standfestigkeit zu demonstrieren – die mit Sicherheit auch von ihnen eingefordert wird. Bestimmt quellen die Posteingänge mancher Prominenter seit Tagen über vor Nachrichten wie: „Äußere dich zu Gaza!“ Oder: „Warum sagst du nichts zu den hungernden Kindern?“
Also äußern sie sich nun und sagen was. Unterzeichnet haben – wie fast jeden offenen Promibrief der vergangenen Jahre – unter anderem Jella Haase, Daniel Brühl und Joko Winterscheidt. Die Namen lesen sich wie der Cast der vergangenen Staffeln von „Wer stiehlt mir die Show?“. Seit der Erstveröffentlichung dieses offenen Briefs ist die Zahl der Unterzeichnenden noch gestiegen: Mit Stand Donnerstagmorgen haben sich insgesamt 367 Prominente dem Aufruf angeschlossen. Laut der Kampagnengruppe Avaaz, dem Weltmarktführer bei offenen Briefen, gehören jetzt auch Nina Chuba, Clueso und Sandra Hüller zu den Unterzeichnenden.
Auf der Kampagnenseite von Avaaz findet sich unter den Namen folgender Satz: „Dieser Brief, den die Kulturschaffenden gemeinsam mit Avaaz lanciert haben, sorgt bereits deutschlandweit für Schlagzeilen – von Spiegel und Stern bis hin zu Deutschlandfunk und Zeit.“ Das ist der Kern des Anliegens, das will dieser Brief: Schlagzeilen erzeugen.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Das richtige Gefühl ersetzt das richtige Argument
Man kann der Meinung sein, dass Schlagzeilen, Medien, die Presse eben dafür da sind, Aufmerksamkeit auf gewisse Themen zu lenken, und dass Aufmerksamkeit Veränderungen anstoßen kann. Man kann auch der Meinung sein, dass für diese Aufmerksamkeit jedes rhetorische Mittel recht ist, auch ein offener Brief, geschrieben mit Bausteinen aus dem Fachhandel für Betroffenheitspathos: „Kinder, abgemagert bis auf Haut und Knochen, die Augen leer, die Handgelenke dünn. Babys, vor Hunger zu schwach, um zu weinen. Alte, schwache und kranke Menschen, die keine ausreichende Versorgung erhalten. Die in Gaza sterben. Tag für Tag. Dabei sind es Menschen. Mütter. Väter. Kinder. Kinder wie unsere. Kinder wie Ihre.“ Niemand, wirklich niemand, der ein Herz hat und bei Verstand ist, kann dem widersprechen.
Man kann sich auch gut vorstellen, als prominenter Mensch zu Hause zu sitzen, die Bilder aus Gaza zu sehen und zu denken, man müsse jetzt mal dringend was tun. Die Frage ist nur: Muss es das Unterschreiben eines Briefs sein? Warum spenden sie nicht Geld, damit Lebensmittel bei den Hungernden ankommen? (Tun vielleicht einige.) Wieso organisieren sie keine Demo, um für die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren? Und warum denken Prominente, ihre Haltung, ihre Meinung habe so viel Gewicht, dass sie unbedingt gehört werden müsse (dringender als die Haltung, die Meinung eines Supermarktkassierers in Bielefeld)? Vielleicht, um schriftlich festzuhalten, dass man auf der richtigen Seite steht, denn in einer Welt, die zunehmend moralisch vermessen wird, ersetzt das richtige Gefühl das richtige Argument.
Der Text solcher offenen Briefe ist zumeist so gebaut, dass sich niemand ernsthaft daran stoßen kann: Krieg ist schlimm; Gewalt ist schlecht; Hunger muss aufhören; Menschen sollen nicht leiden. Obwohl sich immerhin ein paar daran stoßen, dass die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln, die sich weiterhin in den Händen der Hamas befinden, nicht zum Forderungskatalog des offenen Briefs gehört.
Denn dieser Katalog sieht so aus: „Stoppen Sie umgehend alle deutschen Waffenexporte an Israel. Unterstützen Sie das Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel. Fordern Sie mit Nachdruck einen sofortigen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.“ Das unterschreiben dann soundso viele Leute, und ein paar Stunden später geht der Brief online. In den Medien heißt es dann: „Prominente fordern …“ – wobei unklar bleibt, ob „fordern“ hier das richtige Wort ist oder ob nicht eher „verlautbaren“ zuträfe.
Denn die Funktion offener Briefe liegt weniger im Appell an die Mächtigen als in der Stärkung der eigenen moralischen Autorität. Längst geht es nicht mehr um die Adressaten, sondern um die Algorithmen. Der Brief spricht nicht zu Friedrich Merz, sondern zu Followern. Er wird politisch wirkungslos bleiben, aber zur Reichweitenpflege mit moralischem Glanz taugt er.
Eingebunden in eine professionelle Kampagnenlogik
Bei offenen Briefen haben wir es mit einer neuen Form der moralischen Selbstdarstellung zu tun, des sogenannten virtue signalling. Der Philosoph Hanno Sauer schreibt in seinem neuen Buch „Klasse – Die Entstehung von Oben und Unten“, das in einigen Tagen bei Pieper erscheint: „ ‚Tue Gutes und rede darüber‘ ist keine sehr neue Einsicht, und auch die Tatsache, dass Menschen versuchen, sich in einem möglichst vorteilhaften Licht zu präsentieren, dürfte kaum als revolutionäre Einsicht in die Tiefen der menschlichen Psyche durchgehen.
Aber in den letzten Jahren erwarb der Begriff der moralischen Selbstdarstellung eine pejorative Konnotation: Wir sind, so schien es vielen, umgeben von Menschen, die zu wenig mehr als moralischen Lippenbekenntnissen bereit sind, aber selten Taten folgen lassen. Dies ist der Verdacht, dass moralische Selbstdarstellung im Kern eine Form der Heuchelei ist.“ Sauer versucht, diesen Verdacht in seinem Buch zu entkräften – bei diesem offenen Brief bleibt aber ein Unbehagen, weil seine Orchestrierung nahezu perfekt ist.
Hinter ihm steht eine Organisation, die wie ein moralischer Verstärker funktioniert, nämlich Avaaz, eine globale NGO, die ein perfekt funktionierendes Kampagnensystem entwickelt hat. Das Prinzip ist simpel: Eine zentrale Plattform erstellt Appelle und sucht dafür medienwirksame Erstunterzeichner. Der Effekt ist maximale Sichtbarkeit bei minimaler Reibung. Das Problem an der ganzen Sache ist nicht der moralische Impuls – der aufrichtig sein mag –, sondern die Einbindung in eine Kampagnenlogik.
Avaaz funktioniert wie ein PR-Büro der ethisch eindeutigen Botschaften. Aber in diesem Büro gibt es keinen Raum für Ambivalenz oder für Komplexität. Malcolm Gladwell hat dieses Phänomen schon vor Jahren beschrieben. In seinem Essay „Small Change“ schrieb er: „Soziale Medien können nicht das leisten, was gesellschaftlicher Wandel immer erfordert hat.“ Zum Beispiel rationalen, herrschaftsfreien Diskurs im Sinne eines öffentlichen Austauschs, der frei von Manipulation, Zwang und Ungleichheit ist.
Wandel benötigt, im Habermas’schen Sinne, eine „Diskursgemeinschaft“, in der Argumente vernünftig ausgetauscht werden können. Ein offener Brief ist aber ein geschlossenes System, in dem eine Antwort (von Friedrich Merz oder Außenminister Wadephul oder sonst wem) überhaupt nicht vorgesehen ist. So wird der offene Brief zur einer Art moralischem Newsletter. Die News stehen nicht im Text – die Liste der Unterzeichnenden ist die Nachricht.
Das alles wäre weniger problematisch, wenn diese Briefe wenigstens überraschten – mit ungewöhnlichen Allianzen, mit intellektuellen Argumenten, mit Widerspruchspotenzial. Aber all das ist nicht vorgesehen, denn statt Konfrontation sucht der offene Brief vom 31. Juli Konsens. Statt Unruhe stiftet er Zustimmung. Was natürlich in diesem Fall auch am Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt, denn er erscheint zu einem Zeitpunkt, da sich gesellschaftlicher Mainstream und Popkultur weitgehend einig sind. „Israel macht Gaza kaputt, Solidarität mit den Palästinensern“ – das ist der Sound der Zeit.
Die Unterschrift kostet Null Komma null
Drei Viertel der Deutschen wünschen sich laut einer aktuellen Forsa-Umfrage „mehr Druck der Bundesregierung auf Israel“. Die sehr angesagte Band Fontaines D. C. versäumt es auf keinem ihrer Konzerte, wie jüngst in Berlin, „Free, free Palestine“ zu skandieren. 80 Prozent der Deutschen kritisieren Israels Vorgehen. Was also bringt ein offener Brief, wenn er die Mehrheitsmeinung reflektiert – und sonst nichts?
Als vor ein paar Wochen einige SPD-Altvorderen ein „Manifest“ zu Russland veröffentlichten, bewiesen sie damit mehr Mut und Diskurswillen als die 367 Prominenten, die das Unterschreiben nichts gekostet hat, Null Komma null. Aber er bringt ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Diese 367 Menschen haben übrigens auch folgenden Satz unterschrieben: „Sie [gemeint ist Friedrich Merz; Anm. d. Red.] haben in den letzten Tagen Stellung bezogen und die israelische Regierung kritisiert. Wir würdigen das, doch eines ist klar: Worte alleine retten keine Leben.“
Moment – wenn dem so ist, warum dann einen Brief unterzeichnen? Was ist denn ein Brief anderes als eine Aneinanderreihung von Worten? Vielleicht hätte ihn vorab jemand redigieren und auf Plausibilität prüfen können.
Oder man hätte ihn gar nicht erst geschrieben.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
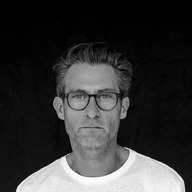






meistkommentiert