Nobelpreis für Peter Handke: Wege des Weltverstehens
Der Nobelpreis für Peter Handke war kein Fehler. Literatur handelt eben vom Menschlichen und damit immer auch von Fehlbarkeiten.
Bist du schon mal von Tolstoi gekommen? – Ne, meistens von Oralsex.“ So oder ähnlich geht der Witz, der neben viel Ad-hoc-Entrüstung auf die Verkündung des Literaturnobelpreises an Peter Handke folgte.
Da stand einer in seiner Heimatstadt und sagte einer Gruppe Journalisten, die sich wenig für seine Literatur, eigentlich nur für seine Begegnungen mit dem als Kriegsverbrecher angeklagten Slobodan Milošević interessierten, von Homer, Cervantes und Tolstoi zu kommen, andere standen im Hier und Jetzt und kritisierten ihn via Twitter und Facebook dafür, dass er im Hier und Gestern bis zu Milošević’ Grab gegangen war. Vielen schien bei der Beweislast auf den ersten Blick klar, welche Seite die richtige ist, und auf der ist man ja immer gern, es sei denn, man ist zufällig Peter Handke.
Weil man auf der richtigen Seite eh alles richtig macht, nahmen die Empörungen mitunter recht bizarre Formen an, von Witzen und Echauffierung oft nur des Hörensagens (der hat ja mal … geht ja gar nicht … ne, gelesen hab ich nichts von dem, und jetzt erst recht nicht!) bis zu Clownsauftritten war alles dabei. Vielleicht ist das mit dem ausbleibenden Tolstoi-Orgasmus auch gar nicht so sehr ein Witz als vielmehr Ausdruck davon, dass viele von jenen, die in tagespolitischer Tweetsprache zu Hause sind, tatsächlich noch nie von Weltliteratur in Ekstase geraten sind und sich einen langfristigen Aufenthalt dort gar nicht vorstellen können oder wollen.
Womit ein Grund gefunden wäre für die Missverständnisse zwischen Handke-Kritikern und -Verteidigern der ersten Empörungswelle: Man spricht in zwei so unterschiedlichen Sprachen von der und über die Welt, dass man die Gegenseite gar nicht ernst nehmen kann, man findet sie je nachdem verschwurbelt oder verkürzt, in jedem Fall grundfalsch.
Dabei ist dies eine der wenigen Feuilletondebatten, die sich wirklich zu führen lohnt, ein Streit, in dem politische und literarische Fragen mit großem Gewicht zusammenkommen. In der Kontroverse um die hohe literarische Auszeichnung an einen intellektuell wie literarisch herausragenden Autor, der sich zugleich im Politischen, in der „sogenannten“ Wirklichkeit, die für andere eine ausbuchstabierte Hölle gewesen ist, so weit verrannte, dass es Folgen hatte weit über die Feuilletonblase hinaus, stehen uralte wie hochaktuelle Fragen in einem nicht ganz so leicht zu entwirrenden Zusammenhang.
Da ist zum einen die Frage, wie fehlbar jemand sein darf, der Großes geleistet hat. Man muss nicht bis zu Knut Hamsuns nationalsozialistischer Parteinahme zurückgehen und diesen schiefen Vergleich bemühen, man kann auf dem Balkan der 1990er Jahre bleiben.
Recht offenkundig sei „die Erkenntnis, dass der Bosnienkrieg für Westeuropäer in Vergessenheit geraten ist – anders ist Handkes Nobelpreisgewinn jedenfalls nicht zu erklären“, meinte Tijan Sila am Wochenende in dieser Zeitung. Allerdings sind, wenn man dieser Annahme folgt, die Katastrophen der jüngsten Vergangenheit noch schneller in westeuropäische Vergessenheit geraten, als an Handke zu sehen wäre.
Der Genozid in Ruanda geschah unter den Augen der UN-Blauhelmsoldaten, die trotz wiederholter Bitten an das Headquarter in New York nicht verstärkt wurden, ihr Mandat nicht erweitert. Das fatale Scheitern der Blauhelme im Angesicht eines Genozids wiederholte sich im Folgejahr in Srebrenica. Seinerzeit in New York verantwortlich dafür war Kofi Annan. Er erhielt den Friedensnobelpreis 2001 paritätisch mit der UNO, deren Generalsekretär er mittlerweile war.
Nicht wenigen galt er zum Zeitpunkt der Verleihung längst als perfekte Verkörperung der UN-Ideale, vielleicht, weil man seine Rolle Mitte der 1990er vergessen hatte oder weil Annan zuvor verständliche reumütige Worten gefunden hatte. Es unterscheidet den Diplomaten Annan vom Schriftsteller Handke, es unterscheidet auch ihre Sprache.
Wer nur im Politischen bleibt, übersieht den zweiten Kern des Streits, die Frage, was Literatur ist und kann, wie weit sie irritieren, provozieren, wehtun darf, und ebenso, was mit poetischer Enthobenheit geschieht, wenn der Schriftsteller zum „verdächtigen Zeugen“ wird. Der Streit handelt von einem literarische Sprechen, das sich vorauseilender Sicherheiten zu widersetzen versucht, und von Politik, die das literarische Sprechen kapert, von einem Elfenbeinturm, der gestürmt wird oder von selbst einstürzt.
Was passiert, wenn einer mit Kafkas „Prozess“ in der Hand ein Kriegsverbrechertribunal besucht? Was passiert, wenn jemand, der schon mit Mitte zwanzig das Engagement von der Literatur verwies („Die literarische Form verfremdet das ihr eingeordnete Engagement“, schrieb Handke 1966 und weiter: „Denn engagieren kann man sich nur mit Handlungen und mit als Handlungen gemeinten Wörtern, aber nicht mit den Wörtern der Literatur“), am Grab Milošević’ steht und die fragwürdige Bühne einer poetischen Eindeutigkeitskritik sich als viel stärker erweist als die Aufführung selbst?
Es geht bei Handke nicht allein um einen politischen, sondern auch um einen poetologischen Irrtum. Wer meint, dass poetologische Fragen im Angesicht von Kriegsverbrechen nicht zählen, übersieht, dass mit ihnen verhandelt wird, ob Deutungshegemonien in der Gegenwart nur noch politisch und ökonomisch zu denken sind oder ob es noch andere Formen des Weltverstehens gibt. Es ist ein zweifelndes Fragen, was das denn ist, worauf wir stehen und über das wir uns so eindeutig zu verständigen meinen.
Es sind Fragen im Abseits unserer mutmaßlichen Sicherheiten, und die sind heute so wichtig wie je. Es bewahrt nur nicht automatisch davor, auch dort fehlzugehen. Aber Literatur handelt eben vom Menschlichen und damit immer auch von Fehlbarkeiten. Ein Denken, das diese nicht aushält, nur noch Geschichten über unfehlbar gute Menschen und eindeutig böse Irrgänger erschafft, würde ich in Literatur wie in Politik gleichermaßen fürchten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






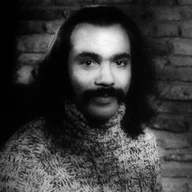

meistkommentiert
Negative Preise durch Solaranlagen
Strom im Mai häufig wertlos
Selenski zu Besuch in Berlin
Militarisiertes Denken
Gender-Trouble bei der „Welt“
Hauptsache Hitler
Klima-Urteil des OLG Hamm
RWE ist weltweit mitverantwortlich
Waffenlieferung an Israel
Macht sich Deutschland mitschuldig?
Bürgergeld und Stereotype
Von „schuldigen“ und von „unschuldigen“ Arbeitslosen