Münchner Sicherheitskonferenz: Macron verdient Aufmerksamkeit
Während die anderen EU-Länder ratlos sind, plädiert Frankreichs Präsident für ein unabhängiges Europa. Doch seine Vorschläge werden kaum diskutiert.
D er Auftritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Samstagmittag war der Höhe- und Tiefpunkt der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz zugleich. Höhepunkt, weil es dem französischen Präsidenten gelungen ist, einer gelähmt und ratlos wirkenden Kaste von westlichen Profipolitikern einen Hauch von Hoffnung und Vision einzuhauchen.
Er hat der „Westlessness“ (Konferenzmotto), also dem sich verflüchtigenden Westen, eine Alternative entgegengestellt: die eines sich stärkenden, sich bewussten, sich nicht wegduckenden Europas, das in der Substanz ohne die Vereinigten Staaten von Amerika auskommt. Im Begriff der „Westlessness“ drückt sich die wachsende Ratlosigkeit über die Abkehr der US-Regierung vom westlichen Bündnis aus.
Diese Ratlosigkeit lähmte nicht nur die Konferenz, sondern die westliche Außen- und Sicherheitspolitik insgesamt. Macrons Auftritt war aber auch der Tiefpunkt der Konferenz: weil er ganz offenkundig keinen Partner findet, der seine Vorschläge aufnimmt, allen voran nicht die Bundesregierung. Es ist ja nicht so, dass Macrons Ideen ausgereift wären, im Gegenteil: Seinen Vorstoß für eine atomare Bewaffnung Europas kann man für absurd halten; seine Forderung nach einer europäischen Armee ebenso.
Und trotzdem: Nur ein eigenständiges, erwachsenes Europa wird zwischen den USA, Russland und China seine Rolle behaupten können. Macrons Vorschläge, so umstritten sie auch sein mögen, verdienen eine leidenschaftliche, laute Diskussion. Man hätte gern die Bundeskanzlerin auf Macron antworten hören, aber die war leider nicht da.
Stattdessen trat eine innenpolitisch ausgeknockte Verteidigungsministerin an, die außenpolitisch schlingert und nicht die Kraft hat, Macrons Initiative angemessen zu beantworten. Irgendwer wird in diesem Europa irgendetwas anstoßen müssen, wenn die Amerikaner Europa abstoßen (und selbst allzu oft abstoßend auftreten). Allez!
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






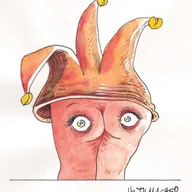
meistkommentiert
Wahl neuer Verfassungsrichter:innen
Brosius-Gersdorf: Bin nicht „ultralinks“
Merz im ARD-Sommerinterview
Hohe Mieten? Nur ein Problem für den Staat, sagt Merz
Geplatzte Richterinnen-Wahl
Keine Kompromisse mehr
Buch über Putins imperiale Strategie
Da knallen die Sektkorken im Propagandastab des Kreml
Rechte Hetze gegen Brosius-Gersdorf
Der lange vorbereitete Feldzug der FundamentalistInnen
Waldorfschulen und Leistung
Auch Waldorfkinder haben ein Recht auf Bildung