Kommentar Polizisten-Kennzeichnung: G20 hat sich doch gelohnt
Wegen der Polizeigewalt beim G20-Gipfel führt Hamburg die Kennzeichnungspflicht für Polizisten ein. Zumindest dafür ist der Gipfel gut gewesen.

E s ist eine innenpolitische Bombe, die Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag gezündet hat: Die Kennzeichnungspflicht für Polizisten wird nun auch in Hamburg eingeführt. Jeder Polizist soll künftig, auch bei Demonstrationen, anhand eines Zahlencodes identifizierbar sein.
Das ist eine bemerkenswerte Kehrtwende: Zwar stand im rot-grünen Koalitionsvertrag, eine solche Kennzeichnung solle „geprüft“ werden. Aber Papier ist bekanntlich geduldig. Papier, auf dem Prüfaufträge formuliert sind, erst recht. Kam schon der Wunsch der Grünen, dies uralte Ziel festzuschreiben, eher pflichtschuldig daher, so musste eine Umsetzung mit der Law-and-order-SPD von Olaf Scholz als ausgeschlossen gelten.
Grote selbst hatte sich noch im vergangenen November im taz Salon äußerst bedeckt gehalten: „In keinem einzigen Fall“ habe eine fehlende Kennzeichnung verhindert, dass Polizeiübergriffe während des G20-Gipfels ermittelt werden konnten, sagte der Innensenator damals.
Dennoch werde man das Thema „in Abstimmung mit den Polizeigewerkschaften“ prüfen, so Grote. Das ist normalerweise ein Todesurteil für das Projekt Kennzeichnung, denn wenn die zerstrittenen Gewerkschaften sich über eines immer einig waren, dann darüber, dass mit ihnen eine Kennzeichnungspflicht nicht zu machen wäre. Will man sie trotzdem durchsetzen, muss man sich mit den Gewerkschaften anlegen. Und das fällt der in ihnen stark verwurzelten SPD traditionell schwer.
Immer mehr Belege für rechtswidriges Handeln der Polizei
Dass Grote es nun trotzdem wagt, hat mit den immer klarer werdenden Fakten zu tun: Noch ein Jahr nach dem Gipfel kommen alle paar Tage Belege für rechtswidriges Handeln der Polizei ans Licht; urteilen Gerichte, dass die Staatsmacht in diesen Tagen systematisch das Recht gebeugt hat. Wohlgemerkt: die Polizei als Kollektiv. Gegen einzelne Polizisten gibt es nach wie vor keine einzige staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Und die Polizei selbst musste inzwischen einräumen, dass ihre internen Ermittlungen in elf Fällen im Sande verlaufen waren, weil die betreffenden Beamten nicht zu identifizieren waren.
„Nur“ elf Fälle, könnte man sagen. Das sind wenige angesichts der massenhaften kleinen und großen Rechtsverletzungen von Amts wegen, die in den Gipfeltagen rund um den Tagungsort in den Messehallen zu beobachten waren. Aber es sind eben jene paar Fälle, die erstens angezeigt oder ermittelt wurden und in denen zweitens die übrigen Beweise für einen konkreten Anfangsverdacht reichten. Wenn die nun mangels Identifizierbarkeit der Tatverdächtigen nicht zur Anklage kommen, bedeutet das faktische Immunität für die Polizei als Ganze.
Polizeigewerkschaften und die CDU heulen nun auf, Grote falle den Beamten in den Rücken; die Kennzeichnungspflicht sei eine Misstrauensbekundung gegenüber der Polizei. In Wahrheit ist Grote schon einen Schritt weiter: Er hat erkannt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei durch den G20-Gipfel bereits schwer erschüttert, wenn nicht zerstört ist.
Und zwar von zwei Seiten: Einerseits fühlen sich Hamburger Bürger von der Polizei verlassen; schutzlos einem plündernden Mob ausgesetzt. Andererseits haben Bürger die Polizei tagelang als willkürliche agierende, durch Wohnviertel marodierende Besatzungsmacht erlebt, die nichts und niemand Rechenschaft schuldig schien, agierte sie doch unter dem Schutz der Anonymität – und der regierenden SPD.
Grote versucht, Vertrauen zurückzugewinnen
Grote versucht nun, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen – für seine Polizei, und für seine SPD. Bei den einen, indem er zumindest mal die Voraussetzung dafür schafft, auch individuelles Polizeihandeln gerichtlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu bestrafen. Bei den anderen, indem er eine neue Spezialeinheit aufstellt, die in der Lage sein soll, mit Situationen wie jener im Schanzenviertel während des Gipfels umzugehen: Damals hatte die Polizei Plünderer stundenlang gewähren lassen-. Sie wartete darauf, dass eine Einheit der Bundespolizei mutmaßliche Randalierer von einem Baugerüst holte, die Fußtruppen der Polizei hätten gefährden können.
Mit dieser Begründung jetzt eine neue Einheit aufzustellen, ist natürlich grober Unfug, denn die Hamburger Polizei hat ja längst das Mobile Einsatzkommando, das genau für solche Lagen trainiert und ausgerüstet ist. Grote verstärkt nun lediglich diesen Bereich. Und dennoch ist es ein geschickter Schachzug: Er lässt so ein bisschen die Muskeln des Rechtsstaats spielen. Aber vor allem hat er sich damit Zustimmung erkauft: die von Polizeichef Ralf Martin Meyer und die des zum Chef der Schutzpolizei weggelobten G20-Gesamteinsatzleiters Hartmut Dudde. Beide durften bei der Vorstellung von Grotes Plänen mit in die Kameras lächeln.
Schwieriger dürfte Zustimmung für Grotes Vorstoß an der Basis der Polizei zu erlangen sein. Und auch in der Politik gibt es erheblichen Unmut, nicht nur bei der Opposition. Grote hat die rot-grüne Koalition überrumpelt. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen Antje Möller hatte noch vor kurzem ihren eigenen Justizsenator Till Steffen öffentlich gerüffelt, als der die Kennzeichnungspflicht gefordert hatte. Das sei immer noch Sache der Parlamentarier, hatte sie ihn, obwohl in der Sache einverstanden, angeblafft. Nun wird es schwierig für den kleinen Koalitionspartner, die Erfüllung der eigenen Forderung auch als eigenen Erfolg zu reklamieren.
Wenn die Bürgerschaft Grotes Pläne in Gesetzesform gießen muss, könnte es interessant werden: Dann wird sich zeigen, ob die Hamburger SPD schon bereit ist für die Nach-Scholz-Ära. Dann wäre der G20-Gipfel am Ende doch noch für etwas gut gewesen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





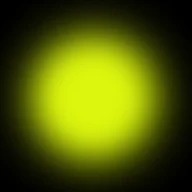


meistkommentiert
Dobrindt will Gespräche mit den Taliban
Abschieben für die AfD
Geplantes Primärarztmodell
Ist da wirklich was, Frau Doktor?
Ein Jahr Pflicht für Tethered Caps
Befreit die Deckel!
Demo gegen Abschiebehaft in Arnstadt
„Wie sollen Menschen das aushalten?“
Schwarz-rotes Stromsteuer-Fiasko
Vertrauen im Eiltempo verspielt
Fahrassistenzsysteme
Wo Autofahrer:innen genervt den Aus-Knopf suchen