Georgische Autorin über Sowjetunion: „Eine patriarchale, gewalttätige Zeit“
Russland werde unter Putin seine Geschichte nie aufarbeiten können, sagt die aus Georgien stammende Theaterregisseurin und Autorin Nino Haratischwili.
taz: Frau Haratischwili, seit einem Jahr sprechen die Waffen in der Ukraine. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Es war ein schreckliches Jahr und zugleich ein Jahr der Wende. 2022 hat viele Paradigmen verändert. Das Echo dieses Krieges ist fast überall in Europa, aber auch im postsowjetischen Raum zu hören. Europa ist solidarisch mit der Ukraine, weil die Europäer die Gefahr existenziell spüren, weil die Ukraine so nah liegt.
Die georgisch-deutsche Theaterregisseurin, Dramatikerin und Romanautorin wurde 1983 in Tbilissi, damals Sowjetunion, geboren und wuchs dort auf. Von 1995 bis 1997 lebte sie in Deutschland, weil ihre Mutter mit ihr vor dem Bürgerkrieg in Georgien geflohen war. Mit ihrem Romandebüt „Juja“ (2010) stand Haratischwili auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihr letzter Roman, „Das Mangelnde Licht“, spielt zur Zeit des Zerfalls der Sowjetunion und erschien kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.
In Ihrem monumentalen historischen Roman „Das achte Leben“ haben Sie sich ausführlich mit der sowjetischen Vergangenheit, vor allem Georgiens, aber auch Russlands beschäftigt. Sie schreiben über das Zarenreich, die Revolution, über Terror im Stalinismus, über Repressionen, Perestroika und den zunehmenden Nationalismus. Wo sehen Sie Lücken im Westen bei der Aufarbeitung der Geschichte der Sowjetunion?
Leider wird die Sowjetunion nach wir vor nur mit Russland gleichgesetzt, und eine Aufarbeitung findet weder im Westen noch im postsowjetischen Raum statt. Die Menschen haben graue Bilder von Städten in den ehemaligen Sowjetrepubliken vor Augen, wo alle Russisch sprechen und Wodka trinken. Das ist zum Teil ein Klischee geblieben – noch heute. Doch nach der Annexion der Krim und besonders nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 hat sich nach und nach die Vorstellung von Osteuropa geändert.
Woran liegt das?
Das Problem ist immer noch, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts meist aus westlicher Perspektive erzählt wird. Alles, was in der Literatur, im Film passiert, ist aus westlicher Sicht. Es gibt weniger Autor:innen aus dem Osten, die bekannt sind, etwa der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn. Es bleibt unausgeglichen. Deswegen kann Osteuropa – besser gesagt der postsowjetische Raum – nicht auf Augenhöhe mitreden. Ich finde es gerade für Deutschland erstaunlich, wo es doch wegen der DDR mehr Wissen darüber geben müsste. Und das ist nicht nur die Schuld des Westens, das ist auch unsere Schuld. Weil wir als Stimmen aus dem Osten diese Aufgabe auf globaler Ebene nicht geleistet haben. Man scheitert schon bei der Debatte über den Zweiten Weltkrieg.

Was meinen Sie damit?
Mich stört in Deutschland die linke Debatte. Jedes Kind weiß hierzulande, dass Hitler das Böse war. Stalin war genauso ein Diktator wie Hitler und hat Millionen Menschen umgebracht. Das erklärt vieles, warum der Westen Russland zumindest in den letzten 20 Jahren so falsch eingeschätzt hat oder einschätzen wollte. Man muss über den Sowjetsozialismus genau so kritisch reden wie über den Nationalsozialismus.
Gibt es einen Wandel in der Medienberichterstattung?
Ich merke, dass während des Krieges gegen die Ukraine mehr Ukrainer:innen zu Wort gekommen sind. Vor allem zu Beginn des Krieges gab es ein Bedürfnis der deutschen Medien, Menschen aus dem postsowjetischen Raum zu Wort kommen zu lassen. Szczepan Twardoch, einer der bekanntesten Autoren in der polnischen Literaturszene, hat in der schweizerischen NZZ appelliert, mit dem sogenannten Westsplaining aufzuhören. Abgeleitet vom feministischen Begriff „Mansplaining“ beschreibt dieser Begriff das Problem, dass der Westen uns erklärt und belehrt, wie wir unsere Geschichte zu sehen haben. Ich schließe mich seinem Appell an. Er spricht mir aus dem Herzen. Hört auf die Stimmen aus den Ländern, die bereits bittere Erfahrungen mit Russland gemacht haben.
Was bedeutet es, wenn ein Land, eine Regierung die Aufarbeitung historischer Großverbrechen verweigert so wie das postsowjetische Russland?
Wenn ich von der Aufarbeitung im Osten spreche, kann ich Russland leider nicht dazuzählen. Da gibt es für mich keine Zäsur. Es gab eine Zeit unter Boris Jelzin, wo sich die Geschichte anders hätte entwickeln können, es aber nicht getan hat. Aber sonst gab es seit 23 Jahren, seit dem Machtantritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, nie eine andere Form der Entwicklung. Man hat einfach konsequent die Gewaltgeschichte ausgeblendet. Es gab keinen Bruch, wie es in der Ukraine oder in Georgien nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums der Fall war. Russland ist in der Form einer Diktatur geblieben.
Das Erbe der Sowjetunion …
Ich habe überhaupt keine Hoffnung, dass Russland unter Putins Führung seine Geschichte aufarbeiten wird. Wenn ich die Ausschnitte von der Siegesparade am 9. Mai sehe, die Ästhetik, die Rhetorik, das Narrativ, das könnte genauso von Breschnew oder Berija, Chruschtschow oder sogar von Stalin sein. Nichts hat sich geändert.
Zum Beispiel?
Die omnipräsente Angst, die die Sowjetunion auszeichnete. Das einzelne Leben ist nichts wert, für den Kreml ist das eigene Volk nur eine Masse, die in Kriegszeiten als Kanonenfutter verwendet wird. Dazu kommt noch die Verfolgung und Vertreibung kritischer Stimmen. Jegliche Repression und die Einschränkung der Pressefreiheit sind das Erbe der Sowjetunion. Es ist ein mutiertes System, das sich noch ein bisschen mit dem Kapitalismus gepaart hat.
Was bedeutet es für die russländische Gesellschaft, wenn vor allem Medien- und Kulturschaffende Russland verlassen?
Es ist einige Jahre her, als ich das letzte Mal Russland besuchte. Früher argumentierte ich, dass wir in einer globalen Welt leben. Das habe ich überschätzt. Die russische, oder besser gesagt die russländische Gesellschaft lebt heute in einem Informationsvakuum. Die Propaganda hat alles nur noch schlimmer gemacht. Jede Form der kritischen Meinungsäußerung durch Intellektuelle, ob Journalist:innen oder Kulturschaffende, wurde abgewürgt. Das ist ein großer Verlust.
Wird in Deutschland nicht die 70-jährige Geschichte der UdSSR zu sehr nach aktuellen ukrainischen Bedürfnissen umgedeutet, wenn Verbrechen der fraglichen Periode (Stalinismus) „ethnisiert“ beziehungsweise „nationalisiert“ wurden, wie es die Ukraine mit dem Holodomor macht, den sie nur auf die ukrainischen Opfer herunterbricht und in einen genozidalen statt in einen politisch-historischen Kontext rückt, oder die ukrainischen Opfer des Holodomor zu Opfern eines russischen Genozids erhebt. Und tut der deutsche Bundestag der Ukraine wirklich einen Gefallen, wenn er diesem Narrativ folgt?
Das ist eine komplexe Frage. Zu den Hungersnöten kam es während der Kollektivierung, und es ist wichtig zu verstehen, dass das in der ganzen Sowjetunion geschah. Der Bundestag erkennt den Holodomor als Genozid an und das ist meiner Meinung auch richtig. Aber es gab in Nordkasachstan und diversen russischen Regionen ebenfalls mehrerer Millionen Opfer. Die Opfer Stalins wurden historisch nicht auf der gleichen Ebene wahrgenommen wie beispielsweise die Opfer des Holocausts. Ich sehe es kritisch, wenn Verbrechen aus der Zeit des Stalinismus in Bezug auf ihre Nationalität betrachtet werden. Aber besser dieses eine Verbrechen, als gar keines anerkennen.
Im Januar 2023 wurde Ihnen für Ihre Verdienste um die deutsche Sprache die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen, wozu ich Ihnen herzlich gratuliere. Sie beschreiben oft brutale Szenen in Ihren Romanen und Theaterstücken wie zum Beispiel in dem Stück: „Herbst der Untertanen“: „Sie haben ihm alle Zähne ausgeschlagen. Sie haben ihm die Fingernägel gezogen. Sie haben ihn unter eiskaltes Wasser gestellt und dann mit brühend heißem Wasser übergossen. Sie haben ihm den Kopf geschoren und ihm mit glühenden Eisenzangen die Haut durchbohrt. Sie haben ihm die Rippen gebrochen. Die Nase. Die Arme. Aber ihn haben sie nicht brechen können. Sie haben ihm solche Schläge verpasst, dass er sich davon nicht mehr hat erholen können.“ Diese Bilder kennen viele auch heute wieder – aus der Ukraine, aus Russland und Belarus.
Ich will das Publikum nicht schockieren. Das gehört einfach zum Thema. Aber es ist immer davon abhängig, was ich gerade schreibe und beschreibe. Mir geht es da nicht um irgendeinen Effekt. Manchmal braucht der Text zarte Töne, manchmal muss man ins Volle gehen. Mir ist es wichtig, dass die Leser:innen sich mit den Figuren identifizieren können. Im Vergleich zur Medienberichterstattung schafft Literatur ein empathisches Bild, das größere Brücken schlägt. In den Romanen bleibt man bei den Figuren tagelang, sogar wochenlang.
Brauchen wir mehr politische Romane oder soll mehr Politik auf die Bühne gebracht werden?
Das Theater muss nicht mit den Medien konkurrieren und tagesaktuelle Stücke über den Krieg anbieten. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wurden auch viele Projekte zum Thema entwickelt, in denen Flüchtlinge auf der Bühne standen. Ich halte das für eine Anbiederei. Kunst braucht mehr Zeit und Abstand. Ich bin die Letzte, die zensieren möchte, doch man sollte keine Romane schreiben, nur weil sich bestimmte Themen gerade gut verkaufen.
Sowohl ukrainische als auch viele russische Journalist:innen im Exil greifen auf den Vergleich mit dem Nationalsozialismus zurück, wenn sie über den Angriffskrieg in der Ukraine erzählen. Auch Sie stellen Ihre Protagonistin „Kitty“ aus „Das achte Leben“ das Stalinopfer und den Holocaustüberlebenden Fred Lieblich gegenüber.
Die Figur der „Kitty“ ist traumatisiert, kaputt, weil sie viel erleiden musste. Diese Frau könnte sich nur jemandem öffnen, die oder der genauso gebrochen ist. Nur darüber kann Kontakt und Empathie entstehen. Anders wäre es nicht denkbar. Aber generell. Ja, ich würde es mir wünschen, dass parallel zum Nationalsozialismus die Verbrechen, die auf der östlichen Hemisphäre geschehen sind, als genauso schlimm und unmenschlich betrachtet worden wären. Vor allem von russischer Seite wurde die Geschichte manipuliert: Stalin wurde als Sieger präsentiert, nur weil er über den Faschismus gesiegt hatte. Eine gleichberechtigte Anerkennung dieses Terrors ist wichtig für eine zukünftige Annäherung zwischen Osten und Westen.
Ihr letzter Roman, „Das Mangelnde Licht“, der zur Zeit des Zerfalls der Sowjetunion spielt, ist zwei Tagen nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine erschienen.
Das Buch steht in engem Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine. Das konnte ich natürlich nicht vorhersehen. Aber es ist traurig, dass das Buch so eine Art Aktualität bekommt. In diesem Buch wollte ich meine Kindheit und Jugend in einem von Russland abhängigen Georgien verarbeiten. Es ist nicht autobiografisch, sondern Fiktion. Ich wollte eine sehr patriarchale, brutale, hasserfüllte und gewalttätige Zeit aus einer Frauenperspektive erzählen, weil das Land in den Abgrund gerissen wurde und wir nur dank der Frauen diese Zeiten überlebt haben. Während der Lesetour hat man mich ständig darum gebeten, Parallelen zu ziehen. „Warum haben wir nicht alles kommen sehen?“, wurde ich gefragt.
Und was war die Antwort?
Unter anderem aus all diesen Gründen, über die wir vorhin sprachen.
Ein weiteres Thema für Sie bleibt die Migration und Flucht. In einem Ihrer Theaterstücke schreiben Sie: „Ein Flüchtling bleibt ein Flüchtling in diesem gottlosen Land – und zwar für immer.“ Würden Sie sagen, dass dieser Satz auch für Deutschland aktuell ist?
Es ist ein provokanter Satz, der auch viele Migrant:innen betrifft. Wir sehen auch, dass gegenüber den Syrern und Afghan:innen die Stimmung in Deutschland anders ist als bei den Ukrainer:innen. Außerdem gibt es auch unter Migrant:innen und Geflüchteten Rassismus, Ablenkung und Widerstand. Das ist erschreckend und wir dürfen nicht wegschauen.
Werden wir in der Zukunft über dieses Thema von Ihnen, Frau Haratischwili, lesen dürfen?
Das ist nicht ausgeschlossen.
Dieser Text ist Teil der taz Panter Beilage zur taz-Sonderausgabe „Ein Jahr Krieg in der Ukraine“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






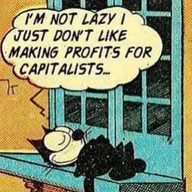
meistkommentiert
Klimagerechtigkeit in Berlin
Hitzefrei für Reiche
Irrsinn des Alltags
Wie viel Krieg ertragen wir?
Artenvielfalt
Biber gehören in die Flüsse und nicht auf den Teller
US-Luftangriff auf Irans Atomanlagen
Trump droht mit „Frieden oder Unheil“
Situation im Gazastreifen
Netanjahus Todesfalle
Diskussion um Kriegseintritt der USA
Zwischen drohen und bomben