Ratenzahlung beim Online-Shopping: Gleich gekauft, später verschuldet
Einfache Optionen zur Ratenzahlung – das ist beim Einkauf im Internet Standard. Doch das Risiko solcher Angebote ist hoch.
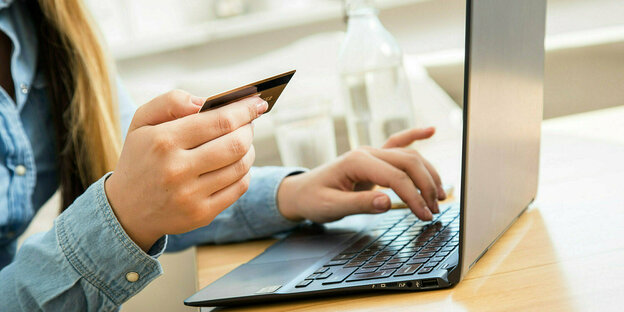
Verbraucherzentralen fordern mehr Schutz bei Online-Käufen Foto:
Christin Klose/dpa
BERLIN taz | Beim Online-Shopping später oder auf Raten zu zahlen wird zunehmend üblich – und ist immer häufiger die Ursache für eine Verschuldung. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Schuldnerberatungsstellen, die die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung am Mittwoch vorgestellt hat. 65 Prozent der teilnehmenden Beratungsstellen berichten demnach, dass Probleme im Zusammenhang mit „Buy now, pay later“-Angeboten im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hätten.
„Buy now, pay later überfordert viele Kund:innen“, sagt Wiebke Rockhoff, Referentin für Schuldnerberatung bei der Diakonie Deutschland. Vielen Betroffenen sei beim Kauf überhaupt nicht klar, dass sie einen Kredit bei einem Drittanbieter abschließen.
„Buy now, pay later“ ist ein modernerer Begriff für Raten- oder Rechnungskauf. Anders als bei den klassischen Modellen lassen sich die Beträge hier kleiner aufteilen und der Kauf ist dennoch schnell abschließbar – ein extra Kreditantrag ist nicht nötig. Verschiedene Zahlungsdienstleister bieten es an, von Amazon Pay über Klarna bis Paypal. Die Details unterscheiden sich, etwa die Höhe der anfallenden Zinsen. Doch die Einladung, erst einmal zu kaufen und sich später um die Bezahlung Gedanken zu machen, ist die gleiche.
„Wir haben so gut wie keine Gläubigerliste mehr, in der nicht ein solches Bezahlsystem vertreten ist“, sagt Marco Rauter, Leiter der AWO Schuldner- und Insolvenzberatung in Berlin-Neukölln. Die Betroffenen verlören häufig den Überblick über die noch ausstehenden Summen. Das könne etwa dazu führen, dass das Konto bei einer Abbuchung nicht gedeckt ist – was die Kosten weiter steigen lässt.
Auch die Bafin warnt
In den Fokus der Kritik geriet „Buy now, pay later“ erstmals, als in den Pandemiejahren Nutzer:innen anfingen, unter Hashtags wie #klarna oder #klarnaschulden Tiktok-Videos mit Screenshots von ihren Klarna-Konten zu posten, auf denen sich teilweise vierstellige Schuldensummen angehäuft hatten. In diesem Kontext warnte auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) davor – weil es schwer fallen könne, den Überblick zu behalten.
Auch von den Verbraucherzentralen kommt Kritik an der Praxis. „Es besteht die Gefahr, sich durch unüberlegte ‚Buy now, pay later‘-Angebote auf Jahre hinaus zu verschulden“, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW anlässlich einer Aktionswoche Ende Mai. Die einfachen Bezahlmöglichkeiten verführten zu Spontankäufen, das Geld fehle dann an anderer Stelle. Gerade für Menschen mit geringer finanzieller Erfahrung könne das problematisch werden.
Verbraucherschützer:innen kritisieren weitere Details: So gebe es Fälle, in der der Zinssatz auf den ersten Blick bei Null zu liegen scheint – das beziehe sich aber nur auf einen begrenzten Zeitraum, dann werde es teurer. Forderungen würden häufig vom Anbieter zusammengefasst, so dass für die Betroffenen nicht mehr ersichtlich sei, was auf welchen Kauf zurückgehe.
Die Berater:innen fordern daher mehr Transparenz für Menschen, die online einkaufen und ein Recht auf Schuldnerberatung für alle Menschen. Zumindest ersteres sieht die EU-Verbraucherkreditrichtlinie vor, die im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Bis diese zum Tragen kommt, wird es aber noch dauern – die Mitgliedsstaaten müssen sie erst bis zum Herbst kommenden Jahres umsetzen.

Leser*innenkommentare
Axel Berger
Sie versuchen immer wieder zu begründen, warum das beim Staat, bei der Schuldenbremse, angeblich ganz anders sei. An anderer Stelle berichten Sie dann von Staaten, die in derselben ausweglosen Lage gefangen stecken, wie die hier besprochenen Konsumenten. Das Problem bei der Verschuldung ist, sie fängt ganz langsam an, wirkt im Vergleich zum Einkommen lange harmlos, und steigt dann irgendwann immer schneller.
Für Deutschland kommen zu den ausgewiesenen Schulden bei zurückgehender Anzahl der Steuerzahler noch Zukunftsversprechen dazu, wie z.B. Pensionen, und Bürgschaften für Banken, die EU und andere.
sollndas
„Buy now, pay later überfordert viele Kund:innen“
Wenn ich mir das Gerangel um die Schuldenbremse anschaue: Anscheinend auch viele Politiker.
Lahmarsch
„Es besteht die Gefahr, sich durch unüberlegte ‚Buy now, pay later‘-Angebote auf Jahre hinaus zu verschulden“, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW anlässlich einer Aktionswoche Ende Mai."
Heißt der Mann tatsächlich Schuld Zins ki ? Stark.