Autor über Ausgrenzung in Schweden: „Rassisten sind kreativ“
Nicolas Lunabba nahm ein sogenanntes Problemkind auf und schrieb darüber. Ein Gespräch über Integration und die Frage, ob Literatur Leben rettet.

Auch in Schweden geht die Schere zwischen Arm und Reich auf. Vorort Rosengård in Malmö Foto: Johan Nilsson/Scanpix/picture alliance
taz: Herr Lunabba, Sie leben in Malmö, einer Stadt, die in den vergangenen Jahren durch Bandenkriminalität und Morde unter jungen Menschen in die Schlagzeilen geraten ist. Sie arbeiten für die NGO Helamalmö, die jungen Menschen aus prekären Umständen hilft. Was machen Sie dort?
Nicolas Lunabba: Im Moment arbeite ich nur noch etwa 40 Prozent für die Organisation, denn in meinem Zweitberuf bin ich Schriftsteller. Ich habe 20 Jahre lang Vollzeit für Helamalmö gearbeitet. Wir haben viel Aufmerksamkeit für unsere Arbeit bekommen, weil wir an der Veränderung der sozialen Dynamik angesetzt haben.
Wir haben den Schwerpunkt nicht auf Kriminalität oder Verbrechen gelegt, sondern uns darauf konzentriert, wie wir ein möglichst gutes Umfeld für Kinder und Jugendliche schaffen können. Wir haben früh erkannt, dass die Grundbedürfnisse der Kinder als Erstes kommen – und alles andere danach.
Nicolas Lunabba
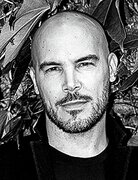
Foto: André de Loisted
Nicolas Lunabba, geboren 1981 in Lleida, Spanien, arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in sogenannten Problemvierteln in Südschweden und erhebt regelmäßig seine Stimme gegen soziale Ungleichheit. Für sein Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Wie war Ihre eigene Einwanderungsgeschichte?
Ich bin in einer kleinen Stadt namens Lleida nahe Barcelona geboren. Ich komme aus einer spanisch-finnischen Familie, zog mit meiner Mutter nach Lund in der Nähe von Malmö. Ich habe also auch einen Migrationshintergrund, aber entscheidender ist vielleicht, dass ich aus der Unterschicht komme, meine Mutter gehörte der Arbeiterklasse an.
In Schweden wurde die Arbeiterklasse lange romantisiert. Meine Erfahrung ist eine andere: In Armut mit einer alleinerziehenden Mutter in einer gefährlichen Gegend aufzuwachsen bedeutete, dass wir ständig um unsere Würde kämpfen mussten.
Wie war Ihr Aufwachsen in Lund?
Die meisten halten Lund für eine sehr wohlhabende Stadt, in der sich vor allem die Mittelschicht und die Studenten tummeln. Aber im Osten der Stadt gibt es eine Gegend, wo viele Einwanderer und ärmere Schichten leben. Dort bin ich groß geworden.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der NGO Helamalmö haben Sie einen muslimischen Jungen namens Elijah bei sich aufgenommen und darüber nun ein Buch geschrieben. Er wird oft als einer der svartskallar (= Kanaken, „Schwarzköpfe“) beschimpft und beschrieben, das Wort taucht ohnehin sehr oft auf.
Es ist ein abwertender Begriff für Ausländer. Er wird vor allem von Rassisten benutzt. Gleichzeitig nutzen vor allem junge Ausländer ihn selbst, weil es eine Möglichkeit ist, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wer du bist oder wer sie denken, der du bist.
Schweden erscheint mir in Ihrem Buch wie ein Land, das aufgeteilt ist in die „bioschwedische“ Bevölkerung auf der einen und die migrantische Community auf der anderen Seite.
Wir müssen erkennen, dass diese Unterscheidung auf einer Lüge basiert. Die Lüge ist, dass ein Unterschied zwischen einem Migranten wie mir und einem weißen Schweden behauptet wird. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, aber es hängt alles davon ab, wie man die Dinge sieht. Es ist eine sehr niedere Art, über Menschen zu denken.
Sie kennen sicher Selma Lagerlöfs Roman „Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden“. Nils Holgersson und Elijah, der muslimische Junge, der bei mir lebte, haben viel gemeinsam. Die Geschichte, die rassistische Rhetorik, die Klassenpolitik und die kulturellen Bezüge haben sie voneinander getrennt, aber sie sind sich sehr ähnlich.
Warum ist die sogenannte Integration in Schweden an so vielen Orten gescheitert?
Zunächst: Ich benutze das Wort Integration nie, denn Integration ist Assimilation. Dahinter steht die Logik: Wenn du dich nicht integrierst, wenn du kein Schwede wirst, dann weisen wir dich aus. Wir müssen über Ungleichheit in Schweden sprechen. Von Mitte der Achtziger an ist die Schere zwischen Arm und Reich in Schweden stärker aufgegangen als in jedem anderen OECD-Land.
Ich will die Zeit davor nicht romantisieren, aber die Schulen funktionierten, und die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft waren nicht vergleichbar mit jenen heute. Schweden galt als Musterland der Gleichheit, auch was Geschlechtergerechtigkeit betrifft. Schweden glauben noch heute, dass das in ihrer Natur liegt. Und sind blind für die Tatsache, dass wir mehr Milliardäre haben als die meisten Länder und zugleich ein großes Problem mit Armut.
Die Schwedendemokraten sind nun mit an der Macht. Jüngst hörte man, dass die Regierung das Militär gegen Bandenkriminalität einsetzen will. Wird Schweden jetzt migrationspolitisch wie Ungarn?
Die Fäden in dieser Regierung ziehen die Schwedendemokraten. Und Rassisten sind sehr kreativ darin, die migrantische Bevölkerung zu bestrafen. In Stockholm wollen sie verhindern, dass es eine Brücke zwischen zwei Stadtteilen gibt, damit sich die Schweden und die Ausländer nicht begegnen. Sie wollen Schwedischtests für Zweijährige einführen. Die Liste ist lang.
Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Schwedendemokraten aus der Neonazibewegung kommen. Inzwischen haben sie sich nur herausgeputzt und Anzüge angezogen. Das Problem ist, dass die anderen Parteien ihre Rhetorik und ihre Politik den Schwedendemokraten anpassen – um Stimmen zu bekommen.
Ein Problem, das wir gerade eins zu eins mit der AfD in Deutschland haben.
Nicht nur in Deutschland. Es ist ein gesamteuropäisches Problem.
Lassen Sie uns noch mal über Elijah sprechen. Der Junge hat lange Zeit bei Ihnen gelebt, er hatte Schwierigkeiten in der Schule und soziale Probleme. Hat Elijah und das Schreiben über ihn Ihre Sicht auf junge Migranten verändert?
Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste: Absolut nicht. Ich habe so viele Jahre mit Kindern wie Elijah gearbeitet. Und ich selbst war oder bin in vielem genau wie Elijah, nur eine Generation älter. Zugleich war seine Situation in vielerlei Hinsicht viel schlimmer als meine.
Die zweite Antwort ist: Ja. Denn ein Buch zu schreiben, ist eine Erkundung. Und einen dieser Jugendlichen für ein paar Jahre in meiner Wohnung zu haben, 24/7, gab mir die Möglichkeit, die Gesellschaft, die Auswirkungen der Segregation, die rassistische Politik und vieles mehr durch seine Augen zu betrachten.
Wenn ich Ihr Buch richtig lese, lautet der Ausweg: Bildung, Bildung, Bildung. Und Kultur und Literatur.
Nein! Die Vorstellung, dass Literatur unser Leben rettet, ist eine Mittelschichtsperspektive. Wir haben diese Vorstellung, dass Bücher einen Ausweg bieten – oder, im Fall von Elijah, das Basketballspielen. Erst einmal braucht ein solcher Junge aber einen Erwachsenen, der ihm zuhört, der für ihn da ist. Er braucht Zuneigung, regelmäßige Mahlzeiten. Erst dann kann er sich wirklich der Kultur und der Literatur zuwenden und seine Perspektiven erweitern.
Für Sie selbst aber war Literatur eine Art Ausweg, oder?
Das Schöne bei mir war, dass die Literatur erst spät in mein Leben kam – als ich 25 war. Ich fing an zu lesen und wurde zu einem regelrechten Maniac. Erst da habe ich den existenziellen und intellektuellen Wert des Lesens erkannt. Aber es war für mich ein weiter Weg dahin. Ich finde, es stimmt, was Édouard Louis sagt: Bücher können Gewalt repräsentieren für arme, vernachlässigte Menschen. In dem Sinne, dass sie etwas verkörpern, zu dem sie keinen Zugang haben.
Es geht in Ihrem Buch auch um Polizeigewalt gegen Migranten. Hat Black Lives Matter in Schweden diesbezüglich etwas geändert?
Dazu eine Anekdote: Ich habe in Schulen aus meinem Buch gelesen. In einer Schule in einem privilegierten Viertel fragte mich ein Lehrer: „In Ihrem Buch werden Polizisten nicht gerade als nette Leute dargestellt. Spüren Sie nicht die Verantwortung, Kinder und Leser wissen zu lassen, dass es auch gute Polizisten gibt?“
Ich sagte ihm, dass ich in den Jahren, in denen Elijah bei mir wohnte, exakt null positive Begegnungen mit der Polizei hatte. Und ich wollte die Wahrheit schreiben. Denn wir müssen die Wahrheit schreiben – auch wenn sie hässlich ist. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Black Lives Matter hat definitiv mehr Bewusstsein für Rassismus, Sexismus und Machokultur in Schweden geschaffen.






Leser*innenkommentare
Jörg Radestock
Ich denke der Autor hat das Problem klar benannt, die schwedischen Migranten sind eine "Community" während die restlichen Menschen die "Bevölkerung" darstellen. Eine Community ist Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsame Interessen pflegen und sich gemeinsamen Wertvorstellungen verpflichtet fühlen, die wohl von der "Bevölkerung" abweichen. Wie soll da eine Integration funktionieren?
Kurt Kraus
Wenn es die Schweden schon nicht schaffen, wie soll es Deutschland schaffen?