Streit um Klassenfrage: Para und Props
Es gehe um Geld oder um Anerkennung, heißt es in der Debatte um Klassismus oft. Dabei geht es um beides gleichermaßen.
K lassismus, über diesen Begriff streiten gerade viele in einer ziemlich zeitgeistigen binären Entweder-oder-Logik. Die einen sagen, es gehe um Geld, die anderen sagen, es gehe auch um Anerkennung. Und beide Lager werfen einander vor, ihr Fokus verkenne das Problem.
Dabei geht es um beides. Es geht um Anerkennung durch Geld und Geld durch Anerkennung; und das im Sinne des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der nicht nur den Kontostand im Blick hatte, sondern auch soziales und kulturelles Kapital, also Kontakte und Wissen, die mit Geld einhergehen und mit denen Geld einhergeht. Natürlich kann man diese Differenzierung nebensächlich finden und sich radikalcool hinstellen und sagen: Only one solution – revolution! Aber dass sich die materielle Ordnung nicht mal kurz umwälzen lässt, wenn man nur fest daran glaubt und sich dabei nicht von kulturellen und psychologischen Aspekten der Klassengesellschaft ablenken lässt, das wissen wir mittlerweile.
Es gibt Anekdoten, die einem Eltern erzählen, und die, bewusst oder nicht, auch eine Funktion haben: Sie sollen dem Nachwuchs klarmachen, woher der Erzählende kommt, somit auch der Zuhörende. Der Nachwuchs soll erfahren, was es kostet, dass er auf eine bessere Zukunft hoffen kann. Ich erinnere mich an zwei Anekdoten: Mein Vater, der in einer Textilfabrik arbeitet, wird von einem Vorgesetzten in dessen Büro gerufen. Dort wird er forsch zurechtgewiesen, dass er, der Arbeiter aus der Türkei, das Büro gefälligst durch die Hinter- und nicht Vordertür betreten solle.
Meine Mutter geht an dem Gymnasium putzen, an dem ich später mein Abitur mache. Immer wieder erzählt sie meinen Brüdern und mir, woran sie denkt, wenn sie Schultoiletten reinigt: Meine Söhne sollen auch mal auf diese Schule gehen.
taz-Redakteur Volkan Ağar diskutiert mit Lars Weisbrod, Redakteur der ZEIT, über die Renaissance des Begriffs „Klasse“ – und ob dadurch überhaupt irgendetwas anders wird.
Was Haftbefehl rappt
Natürlich wäre mein Vater nicht in einer Fabrik gestanden, hätte er geerbt, meine Mutter hätte keine Klos geputzt. Aber weil es so war, wie es war, taten meine Eltern, was sie tun mussten. Als sie dabei Erniedrigungen erlebten, motivierte sie nicht nur die Aussicht auf zukünftige finanzielle Sicherheit ihrer Kinder, weiterzumachen, sondern auch die Aussicht auf Anerkennung: Ihre Kinder sollten einmal unabhängig genug sein, um sich wehren zu können, um den Respekt einzufordern, der ihnen aufgrund ihrer Abhängigkeit verwehrt wurde; sie sollten nicht mehr in dreckiger Arbeitskleidung Textilmaschinen bedienen oder putzen, sie sollten Hemden tragen und Texte schreiben.
Natürlich ist Letzteres nicht ehrenwerter als die Lohnarbeit, die sie ausübten. Aber die Gesellschaft behauptet das und meine Eltern bekamen es zu spüren.
Deshalb sind meine Eltern heute stolz auf mich, dabei sind sie eigentlich stolz auf sich. Deshalb rappt Haftbefehl nicht die Internationale, sondern: „Mercedes SLS oder S-Bahn fahren? Bandarbeit oder lieber Chef sein?“ Und deshalb geht es um Geld, aber auch um Anerkennung, um Para und Props.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






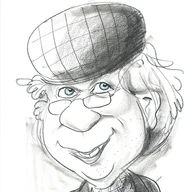
meistkommentiert
Boykotte gegen Israel
Gut gemeint, aber falsch
Café in Gaza-Stadt
„Überall um mich herum lagen Leichen“
Verhältnis der Deutschen zu Israel
Streit bei „Zeit“ über Löschung der Maxim-Biller-Kolumne
Hungerstreik in Ungarn
Maja T. wird in Haftkrankenhaus verlegt
Hitzewellen sind das neue „Normal“
Werde cooler, Deutschland
Hitze und Vorsorge
Der Ventilator allein schafft es nicht