Sozialpädagogen über Inklusion: „Eine radikale Herausforderung“
Sollten alle Kinder mit Behinderung zur Regelschule? Für den Sonderpädagogen Andreas Hinz ist das fällig, für den Kollegen Uli Hoch Überforderung.
taz: Herr Hinz, wie ist das Lernen mit Behinderung zu einem Thema für Sie geworden?
Andreas Hinz: Ich bin einen Teil meiner Jugend auf der Anscharhöhe in Hamburg aufgewachsen, wo es Heime für Kinder mit Behinderung gibt und ich hatte zu einigen von ihnen Kontakt. Das hat mich fasziniert. Nach dem Abi habe ich überlegt, wie ich Zugang finden kann zu Menschen, die anders kommunizieren, und habe mich entschlossen, Zivildienst zu machen in einer Gruppe für schwer mehrfach behinderte Kinder. Das war an einer Schule für geistig Behinderte, so hieß sie damals, bei einer Gruppe mit acht Kindern, die bis dahin überhaupt nicht zur Schule durften. Ich habe den letzten Schritt dahin mitbekommen, dass tatsächlich alle das Recht auf Schule bekamen.
Gab es bei Ihnen auch so einen frühen prägenden Kontakt, Herr Hoch?
Uli Hoch: Ich wollte immer schon Lehrer werden und nach der Schule habe ich Sonderpädagogik studiert. Ein sehr guter Freund von mir war stark sehbehindert und lernbehindert, wir hatten viel Austausch und das war sehr bereichernd.
Andreas Hinz: Darf ich noch etwas hinzufügen – eigentlich ist der Anfang bei mir gewesen, dass mein Vater nur zehn Prozent Sehfähigkeit hat. Ich erzähle das deshalb, weil der Zugang zu diesem Feld ganz häufig mit biografischen Aspekten zu tun hat.
Wie sähe für Sie die ideale Schullandschaft für Kinder mit Behinderung aus?
Andreas Hinz: Ich war in den 1990er-Jahren in der wissenschaftlichen Begleitung von integrativen Grundschulen im sozialen Brennpunkt in Hamburg und da habe ich einige Schulen gesehen, die ziemlich dicht an das herankamen, was ich als die ideale Schule sehe. Allerdings ist für mich Inklusion wesentlich mehr als die Frage von Behinderung. Für mich ist die ideale inklusive Schule diejenige, die tatsächlich für alle Kinder ihres Einzugsbereichs ohne Ausnahme – und da redet der Zivi der „schwer mehrfach behinderten Kinder“ mit – da ist und versucht, den unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfen dieser bunt gemischten Gruppe gerecht zu werden.
Können Sie das näher beschreiben?
Andreas Hinz: Ich habe in Bergedorf in einer Grundschule KollegInnen erlebt, die das toll gemacht haben. Da hatte ich das Gefühl: In die Grundschule wäre ich als Kind gerne gegangen, wo die Kinder die Chance hatten, dass ihre Menschenrechte wichtig genommen werden, dass sie Raum haben, ihren eigenen Lernweg zu gehen, und das im Kontext mit anderen Kindern. Die Kolleginnen haben sich stark als begleitend und viel weniger als führend begriffen. Ich erinnere eine Situation, wo eine Kollegin mit einem Kind am Tisch saß, und sie fragte das Kind, das noch nicht lesen und schreiben konnte: Was ist für dich wichtig? Ich schreib für dich auf, diktier’ mir mal. Diese Verteilung von Funktionen hat mich damals sehr beeindruckt.
Uli Hoch: Ich unterstütze das, was Andreas Hinz über die ideale Schule sagt. Als Praktiker habe ich aber auch die aktuelle Schullandschaft im Blick und sehe, dass immer noch eine große Anzahl der Schülerinnen in den Sonderschulen ist durch die Entscheidung der Eltern, die wählen können zwischen allgemeiner und Sonderschule, die die Kinder angemessen fördert. Herr Hinz sagt zu Recht, dass alle Kinder so mitgenommen werden müssen, wie sie sind, und entsprechend gefördert werden. Und da sehe ich noch eine große Schwierigkeit: Wir haben eine ganz große Bandbreite von Kindern von Hochbegabung bis schwerste Behinderung. Der Anspruch, eine so heterogene Gruppe so zu fördern, zu unterrichten und zu erziehen, ist mit den Ressourcen, die wir jetzt haben, kaum einzulösen.
Warum nicht?
Uli Hoch: Für die Kinder an der Förderschule steht der Leistungsgedanke weniger im Vordergrund. Wir sind eine große Familie mit überschaubaren Strukturen zwischen 150 und 250 Schülern. Die Schüler orientieren sich in diesen kleineren Einheiten gut, wir wollen ja, dass sie selbstständiger werden. Ich halte nichts von ganz großen Schulen, wie wir sie als Regelschulen nun häufig haben. Wenn ich wie heute in der Grundschule bin, wo wir schon Probleme haben, die sechs bis acht Kinder, die alle unterschiedliche Päckchen zu tragen haben, zu integrieren und ausreichend zu fördern – da hätte ich große Bedenken, wenn man sagte, wir würden noch ein Kind mit schwerster Behinderung und ein Kind mit deutlichem Autismus in diese Klasse dazubekommen. Die Gruppengröße ist dafür oft noch viel zu groß.
Andreas Hinz: Zum Stichwort große Schule: Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal in den 1980er-Jahren in die integrierte Gesamtschule Köln-Holweide kam, einer der Leuchttürme der Integration in der Sekundarstufe I in Deutschland. Und ich war entsetzt: ein Riesenbetonbau mit 1.800 Schülerinnen und Schülern von der fünften bis zur 13. Klasse. Aber sie haben eine derartig gute Binnenstruktur, wo drei Parallelklassen in einem Haus sind, sodass es überschaubar wird. Ich möchte noch etwas zur besonderen Förderung sagen. Da muss ich Uli Hoch ein bisschen auf die Füße treten: Manches, was wir an Förderschulen als besondere Förderung veranstalten, hat damit zu tun, dass da so wenig Kinder sind und so wahnsinnig viele Erwachsene und dass die Kinder so wenig Anregung durch andere Kinder bekommen.
Hätten Sie da ein Beispiel?
Andreas Hinz: Als ich Zivi war, gab es in der Schule für geistig Behinderte eine Übungstreppe, da konnte man auf der einen Seite drei Stufen hochgehen und auf der anderen drei Stufen runter. Das ist für mich ein Beispiel, wie manches, was als besondere Förderung initiiert wird, in einer integrativen Situation nicht mehr notwendig ist, weil da 20 Kinder sind, die eine Treppe raufrennen und sich mit darum kümmern, dass ein Kind, das da Schwierigkeiten hat, auch die Treppe raufkommt.
Uli Hoch: Man kann auch in Zwischenschritten auf dem Weg zur Inklusion denken: etwa indem man Kooperationen vertieft. In Schweden gibt es eine Schule, wo auf einem Gelände alle Möglichkeiten vorhanden sind, auch die spezielle Förderung.
Andreas Hinz: Das Thema Kooperation finde ich ein ganz schwieriges. Wir haben ja auch Erfahrungen aus Bundesländern, in denen das gegliederte Schulwesen viel stärker als Tradition vorhanden ist als in Hamburg. In Bayern und Baden-Württemberg etwa wurde lange behauptet, Kooperation sei der Weg zu Inklusion – aber da sind die Erfahrungen zweischneidig. Ich habe eine Freundin in Baden-Württemberg, die in eine Außenklasse einer Schule für geistig Behinderte in der Grund- und Hauptschule gegangen ist. Sie hat sich schon als Schülerin sehr kritisch darüber ausgelassen, dass die Sonderpädagogen immer wollten, dass sie in die „kleine Klasse“ geht und dass da alles noch einmal besprochen wird. Aber für sie war immer klar, dass sich das Leben in der „großen Klasse“ abspielt.
Uli Hoch: Man muss dabei auch sehen, dass die Sonderschulen seit Jahren konstante Schülerzahlen haben. Die Eltern wählen in gleichem Umfang Inklusionsschulen an und ich finde beides gut, weil man das vom Kind aus betrachten muss. Das ist Elternrecht und meiner Meinung nach kann man es ihnen nicht nehmen.
Andreas Hinz: Menschenrechtlich gesehen hat das Kind das Recht auf Teilhabe und Partizipation in der allgemeinen Schule und die Eltern haben die Aufgabe, das Recht dieses Kindes stellvertretend wahrzunehmen – das ist nicht ins Belieben der Eltern gestellt. In Deutschland ist das Elternwahlrecht sozusagen das Friedensangebot, dass wir nicht zu heftig auf einen Systemwechsel losgehen, um den Elternwiderstand klein zu halten – in beide Richtungen. Aber es hat sehr problematische Konsequenzen, wenn wir dauerhaft zwei Systeme parallel vorhalten – das ist das Teuerste, was man machen kann, es verlangsamt die Entwicklung insgesamt und schafft Verteilungskämpfe um Ressourcen. Und es steht nicht mit der UN-Konvention in Übereinstimmung.
An der Schule Weidemoor in Hamburg, die Uli Hoch lange geleitet hat, haben LehrerInnen erzählt, dass sie immer wieder SchulrückkehrerInnen aus Inklusionsklassen bei sich haben. Zeigt das nicht, dass sich eben nicht alle dort aufgehoben fühlen?
Andreas Hinz: Ich weiß aus Integrationsklassen, dass einige Eltern eine wahre Odyssee durch unterschiedlichste Förderschulformen vollzogen haben und nirgendwo zufrieden waren. Häufig ist der Wunsch, das Kind in eine Förderschule zu geben, die Folge der nicht gelungenen Kommunikation zwischen KollegInnen und Eltern, wo nicht genügend vermittelt wird, was gemacht wird und warum es gemacht wird, was realistische Erwartungen für das Kind sind, was nächste Schritte sein können.
Uli Hoch: Ich glaube, dass sich da einiges geändert hat. Die Eltern können hospitieren in den Schulen, es findet ein sehr offener und transparenter Austausch statt. Und ich möchte deutlich widersprechen: Wenn ich heute in einer Grundschulklasse bin, dann sind da viele Kinder, die gar nicht die Zuschreibung Behinderung haben, die aber sehr viel Unterstützung und zusätzliche Hilfen benötigen. Da sind Gruppen zwischen 19 und 24 Kindern. Was Andreas Hinz übers Treppehochlaufen gesagt hat, kann ich voll unterstützen: Nicht behinderte Kinder sind positiv für Kinder mit Einschränkungen. Ich meine trotzdem, dass im Sonderschulbereich die Kompetenz ist, die Kinder direkter abzuholen. Jetzt in der Grundschule ist es so, dass die Kollegen auch fragen: Ihr seid die Experten. Sind wir nicht nur, manchmal sieht es der eine besser als der andere, aber man braucht – und da muss ich sagen, die Sonderpädagogik hat sich weiterentwickelt – dieses Pfund.
Können Sie das konkret beschreiben?
Uli Hoch: Das beste Beispiel ist die ehemalige Gehörlosenschule in Hamburg, die jetzt Bildungszentrum Hören und Kommunikation heißt. Da sitzt ganz viel Kompetenz für Kinder mit Hörschädigung und die Schule unterstützt seit vielen Jahren Kinder, die mit einer Schwerhörigkeit in Inklusionsklassen sind. Sie haben sich geöffnet, jetzt können alle Eltern ihr Kind für Klassen anmelden, wo Hörgeschädigte und Hörende zusammensitzen und es gibt ganz viele Anmeldungen. Natürlich geht es um das Kindesrecht – aber die Eltern müssen einschätzen, was braucht das Kind. Das Kind kann das häufig nicht. Die Jugendlichen nachher, die können das eher.
Und was sagen die?
Uli Hoch: Ich war eine Zeit lang Vertrauenslehrer an einer Sonderschule, wo lernbehinderte Kinder waren in Klassen mit zehn bis 14 Kindern, und die haben gesagt: „Es ist toll bei euch. Hier werden wir angenommen, hier werden wir gefördert und hier können wir unsere eigenen Sachen machen. Das einzig Blöde ist, dass wir als Lernbehinderte tituliert werden.“ Die Paralympics laufen integrativ, aber ich kenne niemanden, der geistig behindert ist und in der Fußballnationalmannschaft spielt. Da haben Menschen mit geistiger Behinderung ihre Nationalmannschaft, blinde Menschen die eigene Fußballbundesliga. Alle Förderschulen haben inzwischen Schülerfirmen, sie haben ihren Schülerrat, sie haben ihre eigenen Wettkämpfe. Der Kreisschülerrat der Sonderschulen hat klare Forderungen an die Behörde formuliert. Mir wäre es wichtig in der Inklusion, dass die behinderten Jugendlichen auch berücksichtigt werden, und das sehe ich im Augenblick nicht so stark.
Ist echte Inklusion überhaupt möglich, solange Bildungspolitik vor allem danach schaut, wie SchülerInnen in internationalen Rankings abschneiden?
Andreas Hinz: Es gibt da deutliche Spannungsverhältnisse: Wenn man einerseits in Richtung einer Schule für alle, also eine immer diskriminierungsärmere Schule geht, und andererseits wollen wir China in Sachen Mathe überholen – das verträgt sich nicht wirklich. Wobei ich es falsch finde, Inklusion Leistungsfeindlichkeit zu unterstellen. Inklusion ist äußerst leistungsfreundlich – nur eben jeweils auf individuellem Level. Jedes Kind soll das lernen können, wozu es in der Lage ist. Nur verabschiedet sich Inklusion von einer Normalitätsvorstellung des Lernens mit Vergleichsarbeiten, dem landesweiten Abitur und Ähnlichem.
Ist von dieser Idee schon etwas in der Praxis angekommen?
Andreas Hinz: Inklusion ist eine sehr radikale Herausforderung des Schulwesens, so wie es bei uns ist. Die menschenrechtliche Anforderung steht in einem massiven Kontrast zu dem, was in Deutschland passiert. Zur Ehrenrettung von Hamburg würde ich sagen, Hamburg macht es noch relativ wenig schlecht im Vergleich mit allen Bundesländern. Aber allein, dass hier zwei Sonderpädagogen sitzen und über Inklusion sprechen, finde ich bezeichnend, und dass wir so austauschbare Begriffe wie Integrations- und Inklusionsklasse haben, zeigt, dass es eher eine rhetorische Entwicklung ist als eine reale. Aus meiner Sicht macht Hamburg nach wie vor Integration, das hat mit Inklusion nicht viel zu tun.
Wo liegt der Unterschied?
Andreas Hinz: Wenn ich die menschenrechtliche Basis von Inklusion angucke, dann geht es um sämtliche Aspekte von Diskriminierung. Und wo kümmert man sich in Hamburg bei Inklusion um die problematische Situation des Coming-out von homosexuellen SchülerInnen, wo kümmert man sich um die Diskriminierung von People of Colour? In Hamburg ist immer noch primär die Sonderpädagogik für die sogenannte Inklusion zuständig.
Wer ist die Gruppe, die am meisten am standardisierten Leistungsgedanken hängt: Eltern, LehrerInnen, Politik?
Uli Hoch: Was den Leistungsanspruch angeht, das sehe ich genau so wie Herr Hinz: Jeder Schüler braucht seinen individuellen Lernweg, natürlich im Klassenverband. Und da muss man als gemeinsame Gruppe aktiv werden: sodass wir gemeinsam an einem Lerngegenstand arbeiten können. Dann ist es die Aufgabe der Pädagogen zu gucken, wie kann ich es planen, dass auch die Kinder, die große Schwierigkeiten haben, sich das anzueignen, einen Zugang finden. Sie sollen nicht nur da sein, sie sollen sich gemeinsam mit den anderen entwickeln. Die inklusive Grundschule Ernst-Henning-Straße, an der ich arbeite, sortiert nicht aus, wir nehmen fast alle Kinder aus dem Wohngebiet auf, das ist ein Weg in Richtung inklusive Schule. Was nicht erreicht wird, dass wir schwerstbehinderte Kinder aufnehmen – da gibt es nur wenige Schulen in Deutschland. Auch diese Kinder haben den Anspruch, in eine allgemeine Schule zu gehen.
Warum hält sich die Idee, dass Inklusion leistungsfeindlich sei, so unerschütterlich trotz aller gegenteiliger Studien?
Uli Hoch: Ich denke, wir alle müssen ein bisschen umdenken, was für eine Schule wollen wir. Wir wollen, dass jeder Schüler etwas leistet, wir wollen ja eine Entwicklung. Aber die Frage ist: Müssen die ganzen Testereien sein? Die ganze Gesellschaft muss da schauen, und noch sind wir auf einer Zwischenstufe.
Andreas Hinz: Wir haben eine sehr starke Tradition des Denkens in Homogenität. Allein wenn Sie sich überlegen, wie die Jahrgangsklasse in Preußen entstanden ist: das preußische Militär wollte die jungen Männer im gleichen Alter für das Militär zur Verfügung haben. Und die Idee, dass der lernende Flottenverband nur so schnell fahren kann wie das langsamste Schiff, ist genauso alt – alle lernen im Gleichschritt. Den Glauben, dass Homogenität leistungsförderlich ist, gibt es seit Jahrhunderten, es stimmt aber nicht. Solches Denken zu verändern, das sind die dicksten Bretter, die wir vor uns haben. Wenn man sagt, Lernen ist ein individueller Prozess, dann muss man auch einen individuellen Maßstab heranziehen. Natürlich ist es legitim, wenn eine Gesellschaft sagt: Nach zwölf oder 13 Jahren sollst du das und das können, aber die wichtigste Bezugsnorm ist die individuelle. Das ist der wirklich zentrale Wechsel, dass wir lernen zu akzeptieren, dass Kinder Subjekte ihres Lernens sind.
Werden die Kinder inzwischen gehört?
Uli Hoch: Da hat sich viel getan. Die Schüler, auch die Schwerstbehinderten – an meiner alten Schule gab es Schwerstbehinderte, die stellvertretende Schulsprecher waren – äußern ihre Bedürfnisse und ihre Forderungen an die Lehrer, Erzieher und die Schulgemeinschaft, die sind wesentlich selbstbewusster geworden. Das Selbstbewusstsein zu fördern, ist ein genauso wichtiger Anspruch wie das Lernen. Und da kann man noch viel machen, da sind wir noch in der Entwicklung.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








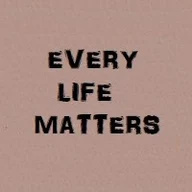
meistkommentiert
Klimagerechtigkeit in Berlin
Hitzefrei für Reiche
US-Luftangriff auf Irans Atomanlagen
Trump droht mit „Frieden oder Unheil“
Irrsinn des Alltags
Wie viel Krieg ertragen wir?
Situation im Gazastreifen
Netanjahus Todesfalle
Artenvielfalt
Biber gehören in die Flüsse und nicht auf den Teller
Mehr als 12.000 Menschen bei Gaza-Demo
„United4Gaza“