Leutheusser-Schnarrenberger und FDP: Die Anschlussverwendung
Die FDP-Minister scheiden schleichend aus dem Amt. Nur für die Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger bedeutet das Ende einen Neuanfang.
BERLIN taz | Das Ende dauert nur acht Minuten. Die weiße Holztür im Schloss Bellevue öffnet sich, und hinter dem Bundespräsidenten schreiten Kanzlerin und Minister in den hellen Saal, als ginge es zur Kommunion. Dabei sind die vier Männer und eine Frau von der FDP. Joachim Gauck sagt: „Ich weiß, das Wahlergebnis ist bitter für Sie und die Freie Demokratische Partei.“
Guido Westerwelle, Philipp Rösler, Daniel Bahr und Dirk Niebel gucken betreten ins Nichts. Kameras klicken. „Ich möchte Sie ermutigen, in guter liberaler Tradition sich weiterhin für die öffentlichen Dinge zu engagieren.“ Die Einzige, die aussieht, als höre sie Gaucks Worte, ist eine kleine Frau im schwarzen Hosenanzug.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kommt in diesen Wochen eine einzigartige Rolle zu. Einerseits gehört die Justizministerin zur alten Garde der FDP. Die Niederlage ihrer Partei bei der Landtagswahl in Bayern hat sie als Landeschefin mit zu verantworten, sie tritt nicht zur Wiederwahl an. Andererseits eröffnet die große Krise ihr eine große Chance. Die 62-Jährige hofft, dass die FDP endlich die Bürgerrechtspartei wird, die diese zu sein behauptet. Von ihr hängt dabei viel ab.
Doch vor dem neuen Anfang steht ein schleichendes Ende. Die Ära der FDP ist vorbei – und darf doch nicht enden. Denn ihre Bundesminister bleiben „geschäftsführend“ im Amt. Offiziell darf das alte schwarz-gelbe Kabinett, solange kein neues steht, weiter Gesetz- und Haushaltsentwürfe einbringen. Und vor einer Woche kam das Kabinett zum ersten Mal seit der Bundestagswahl zusammen. Doch de facto hat Schwarz-Gelb wenig zu bereden und noch weniger zu entscheiden. Die alte Regierung harrt aus, bis die neue steht.
Versteinerte Gesichter
Die Koalitionsverhandlungen und der anschließende SPD-Mitgliederentscheid könnten dazu führen, dass es erst Mitte Dezember so weit ist. Bis dahin dürfen allein Regierungsmitglieder verwaiste Ressorts betreuen, weswegen Leutheusser-Schnarrenberger und die vier FDP-Männer weiterhin amtieren, obwohl ihre Partei nicht mehr im Bundestag sitzt. Im Verfassungsrecht heißt diese Regelung „Versteinerungsprinzip“.
Es scheint auch für die Gesichtszüge der FDP-Minister zu gelten, als Gauck ihnen die Entlassungsurkunden aushändigt und immer das Gleiche sagt: „Danke.“
Philipp Rösler, 40 Jahre, kann seinen Plan, mit 45 Jahren die Politik hinter sich zu lassen, übererfüllen. Im Internet schütten jetzt viele Nutzer anonym Häme über ihn. Sie haben nicht vergessen, wie der Wirtschaftsminister den Mitarbeitern des pleitegegangenen Drogeriekonzerns Schlecker empfahl, sich eine „Anschlussverwendung“ zu suchen. „Danke.“
Guido Westerwelle wird die Frage beantworten müssen, ob er mit 51 Jahren alt genug ist für den politischen Ruhestand. Er kann nach der Europawahl im nächsten Jahr ins EU-Parlament wechseln. Vielleicht wird auch noch ein schöner Sonderbotschafter-Posten frei. Aber eine Rückkehr in die engere Parteispitze gilt als ausgeschlossen. „Danke.“
Daniel Bahr hält eine Hand in der Hosentasche. Der smarte Gesundheitsminister muss darauf vertrauen, dass große Lobbygruppen Interesse an ihm zeigen. „Danke.“
Dirk Niebel steht fern von den anderen FDP-Ministern am Rand. Zu Jahresbeginn sprach er öffentlich aus, was viele dachten, und forderte den Rücktritt von Parteichef Rösler. Der blieb aus. Seither bestätigt sich Julius Cäsars Ausspruch: „Ich liebe den Verrat, aber die Verräter lobe ich nicht.“ Mit ihm will niemand reden, erst recht kein Parteifreund. „Danke.“
Auch Leutheusser-Schnarrenberger forderte zu Jahresbeginn kaum verhohlen Röslers Rücktritt, aber ihre Sonderrolle schützte sie vor innerparteilicher Isolation. „Danke.“
Nach acht Minuten schließt sich die weiße Holztür wieder. Für die vier FDP-Männer ist es womöglich das Ende. Für Leutheusser-Schnarrenberger ist es die Chance zum Neuanfang.
Unter Juristen
Sichtbar wird das fünf Tage vor dem Besuch beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, nur wenige Kilometer entfernt.
Im Plenarsaal des Berliner Kammergerichts, Freitagmorgen. Hallende Schritte auf altem Parkett, rund 50 Herren in schwarzen Anzügen, wenige Damen in schwarzen Hosenanzügen. Um Punkt 9 Uhr betritt eine kleine Frau mit strahlend blauem Blazer und dazu passendem Lidschatten den Saal. Leutheusser-Schnarrenberger sagt jedem, der ihre Hand schütteln will, freudig: „Ich grüße Sie!“ Sie hat allen Grund, guter Laune zu sein.
Die Noch-Ministerin erhält an diesem Morgen den Max-Alsberg-Preis, eine Auszeichnung des Vereins Deutscher Strafverteidiger. Wer Preise verleiht, würdigt auch immer sich selbst. Und hier, unter engagierten Juristen, gilt die 62-Jährige etwas. Am Vortag hat sie ihr Bundestagsbüro geräumt. Nach 24 Jahren. Doch das alles ist an diesem Morgen weit weg.
In einer Pause hat Leutheusser-Schnarrenberger die Wahl, einen Keks zu kauen oder über Politik zu reden. Sie entscheidet sich für beides: „Wenn ich als Noch-Justizministerin komme“, sagt sie kauend, „dann eher zu Terminen, die mit meinem Amt als Ministerin zu tun haben, nicht mit Parteipolitik.“ Sie hat sich den ganzen Tag freigeräumt, um rechtsgeschichtliche Vorträge zu hören. Sie liebt das, sie lebt dafür. Schnell noch ein Keks. Sollte der Niedergang der Rösler-Westerwelle-FDP sie schmerzen, dann überspielt sie ihren Kummer blendend.
Ein Jurist drängelt sich dazwischen, schüttelt ihr die Hand. „Ich wollte nur sagen: Weiter so!“ Dann schwärmt der Mann von den Verfassungsrechtsklagen, die der einstige FDP-Politiker Gerhart Baum bis heute bestreitet. Der 80-Jährige ist neben Leutheusser-Schnarrenberger das letzte Überbleibsel des Bürgerrechtsflügels der FDP. Jener Parteiströmung, die nach dem Koalitionswechsel zur Union 1982 versickerte. Die Ministerin lacht aus dem Bauch heraus: „Danke!“
Eine Überzeugungstäterin
Leutheusser-Schnarrenberger weiß um ihre Sonderrolle. Als die FDP-Mitglieder 1995 in einem Entscheid für den sogenannten Großen Lauschangriff stimmten, trat sie von ihrem Justizminister-Posten zurück. Sie machte sich abseits der Partei einen Namen, führte Klagen vorm Bundesverfassungsgericht an. Seither gilt sie als Überzeugungstäterin.
Vierzehn Jahre nach ihrem Rücktritt, 2009, war sie zurück im Justizministerium. Die FDP-Führung konnte sich nicht durchsetzen mit ihren Steuersenkungsplänen. Die Partei war geschwächt, und damit auch Leutheusser-Schnarrenberger. Ihre Kraft im Kabinett reichte nur, Unions-Vorhaben zu verhindern: Die Ministerin hat das Gesetz zur Sperrung von Kinderpornoseiten im Internet ausgesetzt und die Unterzeichnung des Acta-Abkommens gegen Produktpiraterie zu Fall gebracht. Vor allem aber hat sie sich gegen die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten bei Telefon und Internet gestemmt, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Der Spiegel titelte „Die Blockade-Ministerin“. Das stört sie nicht. Sie ist mit sich im Reinen.
„Zur Vorratsdatenspeicherung und anderen Themen haben wir immer klare Dreiviertelmehrheiten auf Parteitagen“, sagt sie. „Aber nach außen werden diese Themen vorwiegend mit mir verbunden und nicht mit der Partei.“ Und nun? „Da müssen jetzt auch andere FDPler lautstark an der Spitze sagen: ’Jawoll, dafür setzen wir uns ein.‘ Mit einem Lippenbekenntnis zu Bürgerrechten ist es in Zukunft nicht getan.“ Sie lächelt.
Sie lächelt, weil das Desaster der FDP für sie eine Chance birgt. Der alte Strippenzieher Hans-Dietrich Genscher nannte die 62-Jährige in einem Interview nach der Wahl eine „Rechtsstaatsgarantin“. Genscher, sollte das heißen, setzt auch in Zukunft auf sie. Andere, wie Dirk Niebel, brauchen die FDP, um Erfolg zu haben. Aber die FDP braucht Leutheusser-Schnarrenberger, um Erfolg zu haben.
„Ich bin bereit“
Welche Rolle wird sie spielen in der neuen FDP? Wie wird sie ihre Ideen von „Bürgerrechtspolitik auf der Grundlage von politischem Liberalismus“ vertreten? Leutheusser-Schnarrenberger lächelt kurz in sich hinein. Dann sagt sie: „Es ist jetzt zuallererst die Sache von Christian Lindner, wie er sich das Führungsgremium vorstellt. Ich will nicht zu denen gehören, die sagen: ’Ich muss unbedingt dabei sein.‘“ Das hat einen einfachen Grund: Sie muss sich nicht vordrängeln. Die Partei braucht sie. Öffentliche Aufmerksamkeit ist rar für eine außerparlamentarische Oppositionspartei. Die Marke „Schnarri“ wird da umso wichtiger.
Der letzte Keks ist gegessen, sie muss zurück in den Saal, in dem sie vorhin den Preis für ihre Arbeit erhalten hat. Nur ein Satz noch: „Wenn Christian Lindner meint, er kann meine Hilfe gebrauchen, dann bin ich auch bereit, ihn zu unterstützen.“
Dann geht sie zurück in den Saal, wo die Juristen auf sie warten. Zurück in ihre Welt, aus der sie keine Wahl vertreiben kann.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









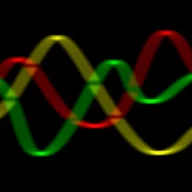
meistkommentiert
Merz’ Anbiederung an die AfD
Das war’s mit der Brandmauer
Rechtsdrift der Union
Merz auf dem Sprung über die Brandmauer
Grünes Desaster
Der Fall Gelbhaar und die Partei
Christian Drosten
„Je mehr Zeit vergeht, desto skeptischer werde ich“
#MeToo nach Gelbhaar-Affäre
Glaubt den Frauen – immer noch
Die USA unter Trump
Moderner Faschismus des 21. Jahrhunderts