Leitbild zur Integration: Agenda 2017
Bewusst anderes Wording: Experten haben im Auftrag von Aydan Özoguz ein „Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft“ entwickelt.
Leitbild statt Leitkultur – so lautet das Credo der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Aydan Özoguz. Deutschland sei ein Einwanderungsland, das sei inzwischen unbestritten, sagte sie am Dienstag in Berlin. Doch wie dieses gestaltet werden solle, darüber gingen die Meinungen auseinander. Auf der einen Seite zeigten Umfragen, dass jeder zweite Deutsche der wachsenden Vielfalt im Lande positiv gegenüberstehe. Auf der anderen Seite sei jeder Dritte dafür, bestimmte Gruppen auszugrenzen, zeigte sich die Integrationsbeauftragte besorgt.
„Eine Gesellschaft macht sich durch Ausgrenzung nicht stärker“, hält Özoguz dagegen. „Aber sie braucht ein Band, das sie zusammenhält.“ Die Idee einer für alle verbindlichen „Leitkultur“ sei aber zu starr, um der historischen Vielfalt und dem gesellschaftlichem Wandel Deutschlands gerecht zu werden. Besser sei es, ein „Leitbild“ zu formulieren, dem sich möglichst viele anschließen könnten.
Unter ihrem Vorsitz tagte eine Expertenkommission aus Wissenschaftlern, Politikern, Verbänden und Migrantenvertretern, um ein solches „Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft“ zu entwickeln.
Am Dienstag stellte Özoguz in Berlin das Ergebnis vor – flankiert von ihren Ko-Vorsitzenden, dem Arbeitsmarktforscher Herbert Brücker und Farhad Dilmaghani von der postmigrantischen Initiative „Deutsch Plus“. Beide lieferten die Eckpunkte für eine politische Agenda, mit der sich dieses Leitbild umsetzen ließe – im Zweifel wohl nach der Wahl.
Dilmaghani plädierte für ein Integrationsministerium, einen besseren Schutz vor Diskriminierung und ein Bundespartizipationsgesetz. Ein Vorbild dafür könnten die Teilhabe-Gesetze sein, wie es sie schon in einigen Bundesländern gibt, darunter Nordrhein-Westfalen.
Brücker sprach sich dafür aus, die Schwellen für Arbeitsmigranten zu senken. Bislang kommen weniger als zehn Prozent aller Einwanderer über ein Visum zur Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland. Die „Blue Card“ der EU für hochqualifizierte Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten ist ein Flop: weniger als ein Prozent der Einwanderer haben sie – die Einkommensgrenzen und andere Anforderungen sind zu hoch. Und auch der Familiennachzug ließe zu wünschen übrig.
Die Ängste vor einem Verdrängungswettbewerb durch Migranten müsse man ernst nehmen, gerade im Niedriglohnbereich, sagte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wenn die Integration der Zuwanderer nicht gelinge, könne dies zu mehr Ungleichheit führen. Doch man müsse „die Verteilungsdebatte auf die Füße stellen“, forderte er. Denn die wachsende Ungleichheit und Segmentierung der Gesellschaft habe nicht ursächlich mit der Migration zu tun. Ihr sei vielmehr mit „klassischer Sozialpolitik“ zu begegnen, von Wohnungsbau bis Quartiersmanagement, so Brücker.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






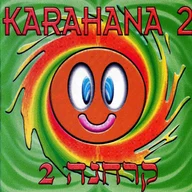
meistkommentiert