Kind oder politische Karriere?: Kinderfreie Zone
Zum ersten Mal lehnten zwei aussichtsreiche KandidatInnen es aus familiären Gründen ab, Hamburgs BürgermeisterIn zu werden. Politische Karriere und aktive Elternschaft gehen noch immer nicht zusammen.
Dass Dressel, der Scholz-Kronprinz, sich wegen seiner drei kleinen Kinder und seiner kranken Mutter schwertat, das Amt jetzt schon zu übernehmen, war bekannt. Dass jedoch alle Parteifreunde und politischen Beobachter trotzdem ganz selbstverständlich davon ausgingen, Dressel würde natürlich zugreifen, spricht für eine problematische Prioritätensetzung.
Ein Politiker darf heutzutage schon mal über die Doppelbelastung lamentieren, die Familie und Amt mit sich bringen, um sich dann aber letztendlich doch bitte für das Amt zu entscheiden. Die Kinder vor die Karriere zu stellen, das kommt praktisch nicht vor. Genau das aber haben Dressel und Leonhard getan und damit einen Tabubruch begangen, für den man ihnen dankbar sein muss.
In diesem Jahrhundert nahmen fast nur Männer auf dem Hamburger Bürgermeistersessel Platz, die kinderlos waren: Olaf Scholz, Christoph Ahlhaus, Ole von Beust. Sein Vorgänger, Ortwin Runde hatte bei Amtsantritt einen volljährigen und einen schon fast erwachsenen Sohn. Der verstorbene Henning Voscherau war somit der letzte Familienvater der Hamburg regierte und Kinder erzog, die noch nicht aus dem Gröbsten raus waren.
Stets informiert
Erzog? Bruder Eggert sagte bei Voscheraus Trauerfeier, er sei auch als Bürgermeister zumindest „über alle Entwicklungen und Ereignisse im Leben der Kinder (…) stets informiert gewesen“. Mehr ging da nicht, aktive Vaterschaft aber fühlt sich anders an. Andreas Dressel lehnt nun ab, weil er mehr als nur informiert sein will, Leonhard, weil Kindersitz plus Bodyguard im Dienstwagen für sie kein harmonisches Bild ergeben. Die Botschaft lautet: Wir haben kleine Kinder, wir sind raus.
Peter Tschentscher hat einen erwachsenen Sohn. Doch wenn faktisch nur auf dem Rathaus-Chefsessel Platz nehmen kann, wer kinderlos ist, oder wessen Söhne und Töchter schon eigene Wege gehen, verbaut das jede Chance auf einen Generationswechsel im Rathaus, etabliert den Ü50-Bürgermeister. Tschentscher ist 52, Dressel wäre 44, Leonhard 40 gewesen.
Tatsächlich lässt sich das Bürgermeister-Amt nicht mit einer aktiven Elternschaft vereinbaren. Der Tag des Bürgermeisters beginnt am frühen Morgen und endet – wenn der Amtsinhaber seine Repräsentationspflichten ernst nimmt – am späten Abend. Handy aus am Wochenende ist unvorstellbar. Wer Hamburg regieren will, muss immer verfügbar sein. Für Parteifreunde, Interessengruppen oder Medien; nicht aber für seine Kinder. Das gehört nicht zur Kernkompetenz eines Bürgermeisters.
Die Entscheidungen von Dressel und Leonhard zeigen: PolitikerInnen von heute stellen ihre Karriere nicht zwangsläufig über alles. Das ist gut so. Das System aber lässt ihnen keine Chance. Und das ist schlecht.
Doch wozu gibt es eigentlich eine Zweite Bürgermeisterin, einen Zweiten Bürgermeister? Der ChefInnen-Job im Rathaus ist so zeitintensiv, dass man ihn teilen könnte, ja müsste. Parteien werden heute oft mit einer Doppelspitze geführt. Warum soll dass bei einer Stadt, einem Land, prinzipiell unmöglich sein?
Engagierte Eltern fördern
In einer politischen Landschaft, in der Familienpolitik, Kitabetreuung, Kinderarmut und Schulentwicklung immer wichtiger werden, ist es nicht ganz verkehrt, jemanden auf dem Bürgermeistersessel zu wissen, der auf dem Spielplatz eine genauso gute Figur macht wie in der Senatsrunde.
Hamburg muss darüber nachdenken, was zu tun ist, um es auch jungen Eltern zu ermöglichen, die Stadt zu regieren. Politikerinnen werden glaubwürdiger, wenn sie nicht nur beklagen, dass in der Wirtschaft noch immer Frauen und engagierten Eltern der Weg in die Führungsspitze verbaut ist, sondern Lösungen finden würden, dass es im eigenen Laden anders läuft. Die Entscheidung von Dressel und Leonhard verdient deshalb nicht nur Respekt, sie mahnt auch Veränderung an.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

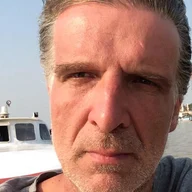




meistkommentiert
Nach Russland-„Manifest“
Ralf Stegner soll Parlamentarisches Kontrollgremium verlassen
Selbstfahrende Fahrzeuge von Tesla
Ein Weg weg vom Privatauto
Rechtsextreme Medien
Doch kein „Compact“-Verbot
Nachrichten im Nahost-Krieg
Waffenruhe wieder vorbei
Volksentscheide in Berlin
Den Willen der Mehrheit kann man nicht ignorieren
Studie zu Bürgergeldempfängern
Leben in ständiger Unsicherheit