Instrumentalisierung von Jugendarbeit: Auftrag zum Ausforschen
Die Hamburger Sozialbehörde will von Trägern der Jugendarbeit wissen, ob ihre Besucher*innen (links)extremistische Tendenzen haben.
Die Grenzen verschwimmen. Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit (OKJA) sollen der Sozialbehörde über die politischen Einstellungen ihrer Besucher*innen Auskunft geben. So will Hamburgs Senat „linker Militanz“ unter Jugendlichen vorbeugen.
Gefragt aber wird nicht nur nach der Gewaltbereitschaft, sondern auch nach dem Kleidungs- und Sprachstil oder dem Gedankengut der Heranwachsenden. „Die Einrichtungen werden instrumentalisiert, um Jugendliche auszuforschen“, sagt die Fraktionschefin der Linken, Sabine Boeddinghaus.
Stein des Anstoßes ist eine Umfrage der Sozialbehörde, über die die taz Anfang Januar berichtet hat. An 150 Einrichtungen der Jugendarbeit – vom Jugendclub bis zum Bauspielplatz – wurde voriges Jahr ein Fragebogen zu möglichen „extremen Haltungen“ der Besucher*innen verschickt. Erstmals wurde dabei auch nach der „linksradikalen Ausrichtung“ der Jugendlichen gefragt. Frühere Umfragen hatten nur nach einer möglichen rechtsradikalen, fundamental-konfrontativ-islamischen oder allgemein „menschenfeindlichen Ausrichtung“ geforscht.
Die Erweiterung des Fragenkatalogs ist eine Folge der Auseinandersetzungen während des Hamburger G20-Gipfels 2017. Der Senat richtete danach eine „überbehördliche Arbeitsgruppe“ ein, an der neben der Sozialbehörde auch die Polizei und der Verfassungsschutz teilnehmen, um sich über „linke Militanz“ und staatliche Gegenmaßnahmen auszutauschen.
Senatskonzept gegen linke Militanz
In seinem Konzept zur Bekämpfung linker Militanz hatte der Senat 2019 noch „ausdrücklich“ darauf hingewiesen, dass es dort ansetze, „wo Grenzen legitimen Protestes und der radikalen Meinungsäußerung überschritten werden und er in gewaltbereites, gewalttätiges und militantes Verhalten umschlägt“. Doch die Praxis hat das Konzept längst überholt.
Der innenpolitische Sprecher der Linkspartei, Deniz Celik, beklagt, dass „der Fragenkatalog nicht, wie im Konzept vorgesehen, auf Gewalt bezogen ist, sondern auf die politische Einstellung.“ Sein Fazit: „Der Senat versucht stümperhaft seine wahre Absicht, Erkenntnisse über den Linksextremismus zu sammeln, zu verschleiern“. Die Linke fordert, dass „diese Praxis unverzüglich eingestellt wird“.
Boeddinghaus und Celik wollten nun in einer Kleinen Anfrage an den Senat wissen, wieso „Jugendliche, die ein T-Shirt mit Antifa-Emblem tragen oder Flyer zu einer linken Demo auslegen, ein Fall für Präventionsarbeit“ sein sollen.
Die Antworten bleiben allgemein: Es könne „erforderlich sein, dass pädagogische Fachkräfte auf junge Menschen einwirken, die sich gegen die demokratische Ordnung wenden“. Weiter heißt es: „Meinungsäußerungen durch das Tragen von T-Shirts oder Emblemen, das Auslegen von Flyern oder sprachliche Äußerungen sind gemeinsam mit weiteren Verhaltensweisen entsprechend zu interpretieren.“
Träger boykottieren Umfrage
Fast alle Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit ließen den Fragebogen unbeantwortet. Sie dürfen gespannt sein auf eine von der Sozialbehörde auf den 3. Februar terminierte Online-Fachtagung mit dem Titel „Linke Militanz – Bedarfe und Möglichkeiten der OKJA“, zu der sie eingeladen wurden.
Die Interessenvertretung Offene Arbeit Hamburg (IVOA) fragt in einer bislang unveröffentlichten Stellungnahme: „Aus welchem Grund werden zunächst diverse extremistische Orientierungen junger Hamburger Bürger abgefragt, in der Fachveranstaltung aber konzentriert ausschließlich das Thema ‚Linksradikalismus‘ erörtert und diskutiert, wo rechter und islamistischer Terror zunehmen?“
Die IVOA sieht in dem Fragebogen „die Instrumentalisierung der Offenen Kinder-und Jugendarbeit“ und betont mit Blick auf die Arbeitsgruppe von Polizei, Verfassungsschutz und Sozialbehörde: „Soziale Arbeit kann nie Teil der Ermittlungsbehörden sein und der Exekutive zuarbeiten.“
Vor allem aber wehrt sich das Gremium gegen eine „mögliche Diffamierung junger Menschen, die sich etwa für mehr Klimagerechtigkeit einsetzten, als Linksextremist*innen“. Sein Credo: „Wenn junge Menschen begreifen, dass ihre Ziele nicht in der derzeitigen Wirtschaftsordnung und Orientierung an Gewinnmaximierung erreichbar sind, sind sie nicht linksradikal, sondern entwickeln ein politisches Bewusstsein.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

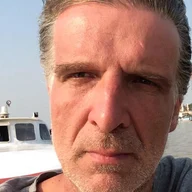




meistkommentiert