„Hate-Tweets“ in den USA: Die Geografie des Hasses
Homophobie, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit: Diskriminierende Begriffe tauchen in US-Tweets vor allem im Osten und auf dem Lande auf.
BERLIN taz | Das „Geography of Hate Project“ hat den diskriminierenden Sprachgebrauch in Online-Netzwerken am Beispiel des Kurznachrichtendienstes Twitter untersucht. Das Ergebnis ist eine interaktive „Hass-Karte“ der USA. Sie zeigt, wo am häufigsten diskriminierende Inhalte vorkommen und ermöglicht die Suche nach einzelnen Begriffen oder nach den Kategorien „homophob“, „rassistisch“ oder „behindertenfeindlich“.
Analysiert wurden sämtliche Tweets in den USA zwischen Juni 2012 und April 2013, bei denen die Geokodierung – die geografische Herkunft – bekannt ist. „Hass-Tweets“ werden vor allem in kleineren Städten und auf dem Land verfasst, zeigt die Karte der kalifornischen Humboldt State University.
So fanden sich im Verhältnis in der wenig besiedelten Mitte North Dakotas mehr rassistische Kurznachrichten als in Fargo, der größten Stadt des Bundesstaates. Homophobe Inhalte sind insgesamt weiter und gleichmäßiger verbreitet als rassistische, die vor allem im Südosten der USA auftauchen. Die meisten homophoben Tweets fanden sich in der spärlich bewohnten Region zwischen Oklahoma und Texas, die größte Häufung rassistischer Tweets gab es im Westen Indianas.
Die Bevölkerungsdichte und das unterschiedliche Mediennutzungsverhalten wurden herausgerechnet. Die Karte zeigt demnach, wo der Anteil diskriminierender Begriffen im Vergleich zum Gesamtaufkommen der Kurznachrichten in der jeweiligen Region besonders hoch ist.
Ein Beispiel: Im kalifornischen Orange County tauchen absolut betrachtet die meisten diskriminierenden Begriffe auf. Da aber auch die Twitter-Aktivität im bevölkerungsreichsten Bezirk Kaliforniens USA-weit am höchsten ist, relativiert sich der Effekt: Es gibt dort keine besondere Häufung diskriminierender Inhalte. In der Nähe von Springfield, Missouri, hingegen schon:
Nach der US-Wahl 2012 wurde bereits ein ähnliches Projekt durchgeführt, bei dem rassistische Inhalte von Tweets als Reaktion auf die Wiederwahl Obamas untersucht wurden. Die Obama-Studie wurde kritisiert, weil die Konnotation der Begriffe nicht untersucht wurde.
Das „Digital OnLine Life and You“-Projekt („Dolly“) des Fachbereichs Geografie der Universität von Kentucky liefert das Datenmaterial für die „Hass-Karte“.
Dort werden Milliarden von geokodierten Tweets gespeichert und der Forschung kostenlos zur Verfügung. Aktuell gehen rund acht Millionen geokodierte Tweets täglich in die Datenbank ein. Insgesamt sind seit Dezember 2011 über drei Milliarden Kurznachrichten gespeichert worden.
Für die „Hass-Karte“ wurde nun auch analysiert, in welchem Kontext die Begriffe benutzt wurden: positiv, negativ oder neutral. Nur Verwendungen in einem abschätzigen Kontext fanden Eingang in die Karte. Die Geografiestudenten suchten „bitch“, „nigger“, „fag“, „homo“, „queer“, „dyke“, „darky“, „gook“, „gringo“, „honky“, „injun“, „monkey“, „towel head“, „wigger“, „wetback“, „cripple“, „cracker“, „honkey“, „fairy“, „fudge packer“, „tranny“. Dabei wurden auch unterschiedliche Schreibweisen beachtet. Sie fanden 150.000.
Hass auf Einwanderer
Einen interessanten Befund lieferte der Begriff „Wetback“, der im Südosten der USA verbreitet ist und abfällig mexikanische Einwanderer bezeichnet. Über „Wetbacks“ wird vor allem dort getwittert wo kaum illegale Einwanderer auftauchen – und nicht in den grenznahen Regionen.
„Bitch“ tauchte übrigens 5,5 Millionen Mal auf. Der Begriff wurde nicht weiter untersucht. Der Grund: Ein Student bekommt zehn US-Dollar für die Analyse von 1.000 geocodierten Tweets. Das entspricht einem Kostenaufwand von rund 55.000 Dollar für „bitch“ – und das war der Uni zu teuer.
🏳️⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️🌈
Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

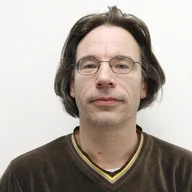





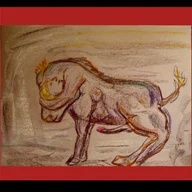

meistkommentiert