Gemeinde-Vorstand über Antisemitismus: „Das ist nicht zu verarbeiten“
Grigori Pantijelew berichtet über antisemitische Vorfälle in Bremen, die nie publik geworden sind, weil die Betroffenen aus Angst vor den Folgen die Öffentlichkeit meiden.
taz: Herr Pantijelew, es herrscht weitgehend Konsens darüber, dass der Antisemitismus zugenommen hat, und dennoch werden aus Bremen kaum Einzelfälle bekannt. Warum?
Grigori Pantijelew: Also zunächst einmal gehe ich nicht davon aus, dass der Antisemitismus zugenommen hat – das Thema bekommt nur mehr Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, dass man davon weiß, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Aus der Menge verschiedener Vorfälle wähle ich fünf Erzählungen, die zusammen eine breite Palette antisemitischer Denkmodelle mit sich bringen und zeigen, dass alle Raffinessen der früheren judenfeindlichen Haltung und der heute neu erfundenen antisemitischen Ideen zusammenkommen. Das heißt: Es wird nichts ausgespart und es ist alles da.
Die Betroffenen – es sind allesamt Jugendliche – haben Sie autorisiert, ihre Geschichten zu erzählen.
Ja, und ich erzähle Ihnen diese Geschichten so, wie ich sie gehört habe. Ein Mädchen im Alter von zehn Jahren, befreundet mit einem türkischen Jungen, hört von ihm plötzlich: Ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, weil ihr Juden den Jesus umgebracht habt. Das Mädchen erzählte darüber zu Hause, weil sie nicht verstehen konnte, was sie da gehört hatte. Was an diesem Beispiel so beeindruckend ist: Ein türkischer Junge, der offensichtlich ein uraltes antijüdisches, christliches Ressentiment aufgenommen hat, bekommt es ungefiltert von seiner Umgebung, und auch wenn es absurd ist, ist es die Realität. Dass diese Stigmatisierung so auf das Mädchen übertragen wird, dass sie in seinen Augen die Verantwortung dafür übernehmen soll, das ist Judenfeindlichkeit. So wird sie erzogen.
Das klingt schlimm. Das zweite Beispiel?
In der Schule, im Unterricht, verteidigt ein Junge, zwölf Jahre alt, beim Thema Nahostkonflikt die Position Israels. Die Reaktion der Lehrerin ist: „Warum bist du nicht nach Israel gegangen, um dein Israel zu verteidigen?“ Das heißt, eine verantwortliche Erwachsene legt dem Kind wiederum die gesamte Verantwortung für das Schicksal und den Frieden im Nahen Osten auf die Schultern. An ihm liegt es jetzt, da hinzufahren und in den Krieg zu ziehen. Das ist ein Ressentiment erster Güte. Es ist, was man heutzutage „neuer Antisemitismus“ nennt, es ist israelbezogen und schon wieder zieht es den Kreis um einen Einzelnen, der für alle anderen schuldig gesprochen wird.
Ein haarsträubendes Beispiel, gerade für eine Pädagogin.
Na, warten Sie einmal, bis Sie das nächste Beispiel gehört haben: In einem Gymnasium kommen die Lehrer auf eine glorreiche Idee. In einem Rollenspiel sollen die Schüler die Konfliktparteien im Nahen Osten auf sich nehmen, sodass eine Partei Israel darstellt und die andere Partei die Palästinenser, alles, um hier den lieben Frieden dort zu erreichen selbstverständlich. Man sucht unter den vorhandenen Schülern explizit nach Vertretern dieser Bevölkerungsgruppen. So bekommt ein Junge aus dem Iran die Aufgabe, die Palästinenser zu vertreten, und ein jüdisches Mädchen bekommt die Aufgabe, Israel zu vertreten. Das geht schief, wie es nur schiefgehen kann. Es eskaliert sofort, und der Junge bespuckt das Mädchen und schmeißt auf sie mit Gegenständen. Für das Mädchen ist es eine absolute Katastrophe.
Und was macht die Schule?
Die Schule hat reagiert, sie hat einen Schuldigen gefunden: Der iranische Junge wird von der Schule suspendiert. Wir haben einen Brief an die Schulleitung geschrieben mit der Aufforderung, dies alles neu zu überlegen. Ich finde es beschämend, dass der Junge hier der letzte in der Kette ist, der das verantworten muss. Ich gehe davon aus, dass er überfordert war. Der Fehler liegt aber am Konzept. Auf den Brief haben wir übrigens keine Antwort bekommen.
Es gab auch Fälle mit körperlichen Übergriffen.
Ein Junge ist in seiner gesamten Schulzeit als Jude beschimpft und geschlagen worden. Das geschah in den Pausen, das geschah auf der Straße, es war eine Tortur, die erst endete, als die Schulzeit vorbei war. Und hier gibt es auch eine sehr wichtige Hintergrund-Nuance: Der Junge hat seinen Eltern nicht erlaubt, darüber in der Schule zu sprechen. Er hat das so begründet: Die Lehrer waren als Aufsichtspersonen oft Zeugen, sie haben nie eingeschritten, sich nie eingemischt. So reproduziert die deutsche Schule von heute das Opferdasein deutscher Juden. Und keiner will das gesehen haben.
Das waren jetzt vier Beispiele…
Die letzte Geschichte ist ein Spiegelbild davon. Ein anderer Junge outete sich nie als Jude, auf den Rat seiner Mutter. In seiner Gegenwart wurde ein jüdischer Junge beschimpft und geschlagen, er aber nicht. Als ich davon hörte, habe ich noch ein bisschen nachgebohrt und gefragt: Was hast du gemacht? Und er sagte: Ich war einfach dabei. Das heißt, er kann diese Spaltung in seiner Persönlichkeit aushalten. Aber was sind das für Spuren, die da in der Psyche bleiben, was sind wir für Menschen, dass wir sowas zulassen? Das sind meine fünf Geschichten, und so unterschiedlich, wie sie sind, in der Summe bilden sie die gesamte Palette ab, wie aus einem Lehrbuch.
Den Fällen, die Sie da schildern, ist ja gemein, dass sie alle – bis auf einen, der in einem Senatsbericht zum Antisemitismus verkürzt genannt ist – nie publik geworden sind. Warum haben die Betroffenen so große Angst davor, es zu erzählen?
Ich glaube, das ist vielleicht sogar die wichtigste Frage, noch mehr als die nach den einzelnen Fällen. Die meisten der bremischen Juden kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, wo der Antisemitismus eine staatliche Doktrin war und wo durch die Generationen eine Art Modus gefunden wurde, damit klarzukommen. Man musste es überleben, man konnte dem nicht entkommen. Und eine Möglichkeit war, sich zu verstecken, sich nicht zu outen und es nach Möglichkeit zu verheimlichen. Einen Schutz durch den Staat gab es nicht, so blieb der Rückzug in den engsten Kreis, in die Familie.
Diesen Hintergrund haben die jüdischen Migranten aus der Sowjetunion mitgebracht.
Ja, sie gingen davon aus, dass sie hier mit offenen Armen aufgenommen werden, und dann erleben sie auf diese Weise die Realität und das eine ist mit dem anderen nicht kompatibel. Die Gastfreundlichkeit, die Angebote zur Integration, sie sind alle da, die jüdische Gemeinde zeigt sich offen in der Stadt, ist willkommen – aber auf dem Level der Alltagserlebnisse passiert dann sowas. Das ist nicht zu verarbeiten, und dann greifen die alten Muster: Die Eltern sagen: Behalte es für dich.
Die Betroffenen fühlen sich total alleine?
Es ist auch die Erfahrung mit den Autoritätspersonen, etwa mit Lehrern, die dafür kein Verständnis haben, kein Auge, kein Ohr, und das bleibt hängen. Und die Eltern haben nicht den Mut zu sagen: Okay, du willst vielleicht nicht, dass wir darüber reden, aber wir gehen jetzt in die Schule, in die Gemeinde, in die Presse. Wir hören die Geschichten vielleicht in der Gemeinde, aber nur mit der Auflage, es nicht weiterzusagen – aus Angst, dass es dann noch schlimmer werden könnte. Das heißt, bei uns schließt sich dieser Kreis, weiter geht es nicht.
Damit sprechen Sie das grundsätzliche Problem an, das auch wir beide im Vorfeld hatten: Als Journalistin will ich Geschichten aus erster Hand. Es ist mein Job, Fakten zu überprüfen oder wenigstens die Quelle zu kennen. Die Jugendlichen möchten aber nicht selber sprechen. Und gleichzeitig wissen wir: Je konkreter eine Geschichte ist, umso mehr erreicht sie auch die Menschen.
Ja, eine Art Teufelskreis. Da sind Jugendliche, die das erlebt haben, und hier ist deren Weigerung, damit in die Öffentlichkeit zu kommen und zu berichten, was passiert ist. Sie möchten sauber recherchieren und möchten vor sich selbst verantworten, was man publiziert. Und da bleiben wir hängen, das heißt, wenn ich nicht einmal den Namen nennen darf, nicht einmal das Stadtviertel, weil die Ängste so groß sind, dann druckt das oder sendet das keiner. So bin ich dankbar, dass dies jetzt trotzdem öffentlich wird.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







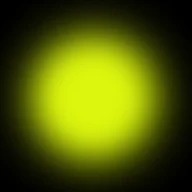
meistkommentiert
Nan Goldin in Neuer Nationalgalerie
Claudia Roth entsetzt über Proteste
Politikwissenschaftlerin über Ukraine
„Land gegen Frieden funktioniert nicht“
taz-Recherche zu Gewalt gegen Frauen
Weil sie weiblich sind
Scholz und Pistorius
Journalismus oder Pferdewette?
Verein „Hand in Hand für unser Land“
Wenig Menschen und Traktoren bei Rechtspopulisten-Demo
Internationaler Strafgerichtshof
Ein Haftbefehl und seine Folgen