Europa in Afrika: „In der zweiten Reihe unterwegs“
Außenminister Steinmeier tut, als erfände er gerade Europas Sicherheitspolitik neu. In den Thinktanks aber erkennt niemand einen Aufbruch.

BERLIN taz | Die deutsch-französische Freundschaft wird in diesen Tagen beschworen, als müssten die Rheinufer im Januar zum Blühen gebracht werden.
Sowohl Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) haben bei Besuchen in Paris umschrieben, wie ein Afrikaeinsatz der europäischen Außenpolitik Profil verleihen soll. Steinmeier und seine Getreuen waren dabei gegenüber dr mitreisenden Presse wohl mitteilsamer als von der Leyen samt Gefolge. Entsprechend verstärkt wurde der öffentliche Eindruck, Steinmeier treibe von der Leyen vor sich her.
Die EU-Außenminister hatten am Montag verabredet, dass Frankreich versucht, die Katastrophe in der Zentralafrikanischen Republik militärisch einzudämmen. Um die Franzosen zu entlasten, verstärkt Deutschland seinen Ausbildungseinsatz in Mali, wo Frankreich 2013 einen islamistischen Umsturzversuch zurückgeschlagen hat.
In Paris betonte Steinmeier nun, Frankreichs Engagement liege im Interesse Europas: „Deshalb finde ich es wichtig, dass Frankreich nicht alleingelassen wird.“ Laut unbestätigten Berichten wird das Mandat zur Ausbildungsmission der Bundeswehr in Mali von 180 auf 250 Soldaten aufgestockt. Diese sollen sich auch selbst schützen können – das Mandat würde robuster. Derzeit sind knapp 100 Bundeswehrsoldaten unbewaffnet vor Ort.
„Wir teilen nicht Frankreichs Risiko“
In den Thinktanks in Berlin werden die neuen deutschen Ambitionen, Europas außenpolitischen Ruf aufzumöbeln, allerdings eher mit Spott bedacht. „Kann schon sein, dass Europa sich regt, aber dann ist Deutschland dabei nur in der zweiten Reihe unterwegs“, sagt Christian Mölling von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Die SWP berät Regierung und Bundestag. Die geringe Aufstockung der Ausbildungstruppe sei „bestenfalls ein kleiner Schritt zurück aus der selbst verordneten Isolation“, sagt Mölling und spielt damit auf Deutschlands Enthaltung in der Libyen-Frage 2011 an. Frankreich, sagt Mölling, habe in Mali die Bedingungen dafür geschaffen, dass Deutschland komme. „Wir teilen noch nicht das gleiche Risiko bei den Einsätzen.“
Auch Sebastian Feyock von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagt: „Im Vergleich zu den Ankündigungen vor dem EU-Verteidigungsgipfel im Dezember ist da noch Luft nach oben.“ Damals „hätte man noch annehmen können“, Deutschland werde sich in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU stärker engagieren.
Mehr Europa ist schon lange geplant
In der Tat hat Berlin sich lange vor Steinmeiers und von der Leyens Amtsantritt mit Paris auf „mehr Europa“ in der Sicherheitspolitik verständigt. So wurde zur Vorbereitung des EU-Gipfels im Dezember 2013 ein deutsch-französisches Papier verfasst, das etwa die Ausrüstung der EU Battlegroups, der seit 2005 vorgehaltenen Eingreiftruppen, für „die wahrscheinlichsten Missionen“ verlangt.
Der Einsatz dieser Battlegroups in Zentralafrika, erklärt Hilmar Linnenkamp von der SWP, wäre tatsächlich ein europäischer Aufbruch gewesen. „Eine leicht verstärkte Kooperation in Afrika ist kein Paradigmenwechsel in der Art der europäischen Zusammenarbeit.“
Linnenkamp, früherer Vizechef der Europäischen Verteidigungsagentur, ist nicht beeindruckt von der deutschen Initiative. „Es handelt sich mit Sicherheit nicht um die Geburt der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU“, sagt er. Deutschland habe „nur ganz genau so viel gegeben, wie es unbedingt musste, um als Partner noch ernst genommen zu werden“. Wie Deutschland von den Atommächten Großbritannien und Frankreich konkret ernst genommen werden soll, lässt er offen. „Wir können mit gutem Grund sagen, dass wir anders sind“, ergänzt Linnenkamp.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





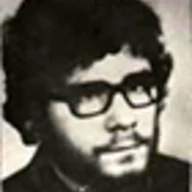
meistkommentiert