NSA-Buch des Guardian-Journalisten: Bericht aus dem Reich des Bösen
Die Story seines Lebens hat Glenn Greenwald über die Überwachung der NSA geschrieben, als Artikelserie und als Buch. Eine Rezension.
BERLIN taz | Edward Snowden sitzt am Tisch und zieht sich eine Decke über den Kopf. Damit will er verhindern, dass Geheimdienste mit Kameras, die eventuell in die Decke des Hotelzimmers eingebaut sind, die Passwörter seiner Laptops ausspähen. Vor die Zimmertür legt er von innen Kissen, damit draußen niemand mithört. Auf dem Tisch stapeln sich leergegessene Teller, Klamotten liegen herum.
So beschreibt der Journalist Glenn Greenwald in seinem Buch „Die globale Überwachung“ die ersten Treffen mit Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in Hongkong. Snowden übergab Greenwald im Frühjahr 2013 Tausende Dokumente, die er während seiner Tätigkeit für mehrere US-Nachrichtendienste illegal heruntergeladen und mitgenommen hatte.
Die Artikel, die Greenwald und seine Kollegin Laura Poitras unter anderem für den britischen Guardian schrieben, lösten außerhalb der USA Erschütterungen aus. Der politische Flurschaden geht über die Reaktionen nach vorherigen Veröffentlichungen von Rechtsverletzungen der USA hinaus. Die Snowden-Enthüllungen stellen die Pentagon-Papiere zum Vietnamkrieg oder den Wikileaks-Film über die schmutzige US-Kriegsführung im Irak in den Schatten.
Greenwalds Buch ist eine Mischung aus politischem Aufklärungsbuch und Agententhriller, in dem selbstlose Helden gegen die finstere Macht kämpfen. An Spannung und Skurrilitäten fehlt es nicht. Beispielsweise schreibt Greenwald, dass ihm die Megastory beinahe durch die Lappen gegangen wäre, weil er zu faul war, ein Programm zur E-Mail-Verschlüsselung zu installieren. Snowden hatte ihn mit diesem Wunsch monatelang anonym kontaktiert – ohne das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Frustriert wandte sich Snowden schließlich an Greenwalds Kollegin Poitras, die die Sache ins Rollen brachte.
Das Buch zu lesen lohnt sich, weil der Inhalt noch immer erschreckend ist. Seine Botschaft formuliert Greenwald mit einer Frage von General Keith Alexander, der bis Anfang 2014 als Chef der National Security Agency (NSA) amtierte: „Warum können wir nicht alle Daten sammeln, immer und jederzeit?“ Dieses Ziel haben die US-Geheimdienste noch nicht erreicht, einen guten Teil des Weges aber haben sie zurückgelegt.
Wahr ist auch: Es gibt kein Arbeitslager
Die Programme, die durch die Snowden-Dokumente bekannt wurden, umfassten laut Greenwald beispielsweise den Zugriff der Schnüffler auf alle Telefon-Metadaten des US-Netzbetreibers Verizon. Dazu gehörten auch die Ausgangs- und Zielnummern, Uhrzeit und Dauer der Gespräche. Es ging um etwa 100 Millionen Telefonanschlüsse.
Dann gab es das Programm Prism, durch das die NSA Zugang zu den Servern der großen Internetfirmen erhielt – unter anderem Facebook, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, Skype. Seit Prism bekannt ist, muss man davon ausgehen, dass dort jeder Chat-Eintrag, jede E-Mail, jede mittels Google geöffnete Internetseite, jeder runtergeladene Song grundsätzlich Material für den Geheimdienst ist. Die Firmen dementierten. Und auch Staaten wie Deutschland waren betroffen. Hier sammelte die NSA offenbar ebenfalls Daten über Hunderte Millionen Telefongespräche. Das Handy der Kanzlerin wurde überwacht. Angela Merkel war sauer.
Greenwald analysiert das alles sehr nachvollziehbar. Drumherum konstruiert er allerdings ein Reich des Bösen – die USA als Regime wie in George Orwells Roman „1984“. Das klingt oft überzogen. Denn Wahrheit ist auch: In den USA werden keine Journalisten erschossen, nur weil sie dem Staat auf die Nerven gehen. Organisationen wie Greenpeace müssen sich nicht als „ausländische Agenten“ registrieren, wenn sie Geld aus dem Ausland bekommen. Und Musikerinnen werden nicht ins Arbeitslager gesteckt, weil sie sich über US-Präsident Obama lustig machen. Alles im Gegensatz zu Moskau, wo Edward Snowden Schutz sucht.
Trotzdem gibt das Buch Anlass zum Nachdenken über die technische Entwicklung. Ist es nicht bald so weit, dass der Kühlschrank merkt, wenn keine Milch mehr da ist, und eine Amazon-Drohne sie automatisch nachliefert? Deshalb ist es gut, das nichtdigitale Leben funktionsfähig zu halten. Also lieber einen Papierkalender benutzen, als den auf dem Smartphone. Stadtplan statt Navi. Bar bezahlen. Autonomie bewahren, auch technisch betrachtet. Nur, damit man’s nicht verlernt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







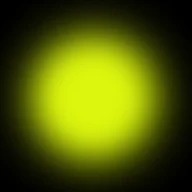
meistkommentiert
Grundsatzpapier von Christian Lindner
Eine gefährliche Attacke
Jüdische Wähler in den USA
Zwischen Pech und Kamala
Alkoholpreise in Deutschland
Das Geschäft mit dem Tod
Experten kritisieren Christian Lindner
„Dieser Vorschlag ist ein ungedeckter Scheck“
Soziologe über Stadt-Land-Gegensatz
„Die ländlichen Räume sind nicht abgehängt“
Krise der Ampel
Lindner spielt das Angsthasenspiel