20 Jahre Hurrikan Katrina: New Orleans allein gelassen
Im Spätsommer 2005 verwüstete der Hurrikan „Katrina“ die Metropole im Süden der USA. Die Politik versagte, 1.800 Menschen ertranken oder verdursteten.

Am 29. August 2005 saß ich wie viele Millionen Amerikaner vor dem Fernseher und schaute wie in Trance CNN, während ein Jahrhundertsturm auf die amerikanische Golfküste und die Stadt New Orleans zuraste. Es waren atemlose Stunden, doch am Morgen des 30. schien das Schlimmste ausgestanden. Hurrikan „Katrina“ hatte zwar Küstenorte wie Biloxi, Gulfport und Bay St. Louis zerstört, doch als der Sturm die Metropole New Orleans erreichte, in der noch immer mehrere Hunderttausend Menschen festsaßen, war er so schwach, dass er keine massiven Zerstörungen mehr anrichtete.
Doch im weiteren Verlauf der Woche schlug die Erleichterung zuerst in Horror, dann in Fassungslosigkeit und Zorn und schließlich in Verzweiflung um. Jeder, der damals die Ereignisse bewusst verfolgte, erinnert sich daran, wie in der Stadt an drei Stellen die Dämme brachen und das Wasser vom Lake Pontchartrain her in die Stadt lief. Zuerst überfluteten die Stadtviertel Lower Ninth Ward, das später zum Symbol der Katastrophe wurde, St. Bernhard Parish und New Orleans East, alles vorwiegend arme und Schwarze Wohnbezirke.
Hilflose Menschen standen auf den Dächern ihrer Häuser, auf die sie „HILFE“ gemalt hatten, und winkten verzweifelt mit Handtüchern und Bettlaken nach Hubschraubern, die nicht kamen. Im Superdome, dem Footballstadion der Stadt, in dem alle, die es nicht aus der Stadt geschafft hatten, Zuflucht gefunden hatten, wurden die Zustände von Stunde zu Stunde grauenhafter. Medizinische Versorgung blieb aus, die hygienischen Zustände verschlimmerten sich rapide, am Ende gab es weder Lebensmittel noch Trinkwasser.
Nachrichtenthema Nummer eins
Spätestens am zweiten Tag, nachdem der Sturm durch die Stadt gefegt war, wurde New Orleans zum weltweiten Nachrichtenthema Nummer eins. Nicht, weil wie praktisch in jedem Jahr, ein tropischer Wirbelsturm am Golf von Mexiko Verwüstungen angerichtet hatte. Sondern wegen des Leides der Menschen, die völlig sich selbst überlassen schienen. Es kamen keine Hilfstruppen der Katastrophenbehörde Fema und kein Militär. Die Menschen ertranken, verdursteten oder starben in Krankenhäusern und Altersheimen, in denen es weder Strom noch Wasser gab und das medizinische Personal Entscheidungen treffen musste, die man keinem Menschen wünschen möchte.
An jenem zweiten Tag erhielt ich Anrufe von mehreren deutschen Zeitungen, darunter der taz, ich solle sofort nach New Orleans aufbrechen. Ich schmiss das Nötigste in eine Tasche, packte meinen Laptop und sprang in ein Taxi zum Flughafen. Unterwegs rief ich das Foreign Press Center an, einen Informationsdienst des US-Außenministeriums für Auslandskorrespondenten, in der Hoffnung, man könne mir sagen, welche Flughäfen in der Region überhaupt noch in Betrieb seien und wo es noch Strom und Benzin gebe.
Die Antwort verriet vieles darüber, was man in den folgenden Wochen und Monaten über diese vollkommen vermeidbare Katastrophe erfahren würde. „Keine Ahnung“, hieß es. „Wir vertrauen darauf, dass ihr uns das von dort berichtet.“
1.800 Menschen ums Leben gekommen
Das Telefonat nahm ein Interview vorweg, das am Morgen des 2. September die CNN-Reporterin Soledad O’Brien mit dem Fema-Direktor, Michael Brown, führte. Darin gab Brown zu, er habe gerade erst davon gehört, dass im Messezentrum von New Orleans 50.000 Menschen ohne Versorgung festsäßen. CNN und andere Medien hatten schon seit zwei Tagen von der Lage im Messezentrum berichtet, wo alte und gebrechliche Menschen, in ihren Rollstühlen sitzend, jämmerlich gestorben waren und nun, notdürftig mit Zeitungspapier bedeckt, in der Hitze standen. „Wie kann es sein“, fragte O’Brien, „dass meine 23-jährige Assistentin bessere Informationen hat als Sie“?
Die Gleichgültigkeit der Bundesbehörden im Angesicht der humanitären Katastrophe auf den Straßen von New Orleans, die in diesem Interview zum Ausdruck kam, endete erst, als dem Bürgermeister der Stadt, Ray Nagin, in einem Radiointerview der Kragen platzte. „Ich möchte keine Pressekonferenzen von Politikern mehr sehen. Ich möchte nichts mehr von 40.000 Mann hören, die angeblich unterwegs sind. Hier ist niemand. Die Leute verrecken auf der Straße. Ich brauche Evakuierungshubschrauber und 500 Fahrzeuge und zwar sofort.“
Am nächsten Tag kamen die Truppen in New Orleans an. Der Superdome und das Messezentrum wurden evakuiert und die Menschen wurden versorgt. Nachdem es tagelang nur Rettungen durch Nachbarn gegeben hatte, begann endlich eine systematische Such- und Bergungsaktion in den überfluteten, zerstörten Straßen. Doch für 1.800 Ertrunkene oder Verdurstete kam jede Hilfe zu spät.
Situation, die an Kriegszustand erinnerte
Ich werde nie die Stimmung in der Stadt vergessen, die noch immer zu drei Viertel unter Wasser stand. Die unerträglich schwüle Hitze, der Gestank des Brackwassers, in dem noch immer Leichen schwammen, das Brummen der Hubschrauber, das den Eindruck einer Stadt im Kriegszustand verstärkte und vor allem die tiefe Verzweiflung der Menschen, die alles verloren hatten und oft keinen Grund mehr zum Weiterleben sahen.
Das Bild des untergegangenen New Orleans, eine der historisch und kulturell bedeutsamsten Städte des Landes, erinnerte an Tableaus von Goya oder Bosch. Es bleibt in der kollektiven Erinnerung der USA als Symbol für ein Staatsversagen, wie es das Land, das sich brüstet, alles schaffen zu können, was es anpackt, noch nie erlebt hatte.
Eine Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre
Doch das Versagen hatte schon Jahre vor „Katrina“ begonnen. Es war unter Ingenieuren bekannt, dass das System an Dämmen und Deichen, dass die Stadt im Mississippi-Delta, die deutlich unter dem Meeresspiegel liegt, unzureichend sei. Die Computersimulation eines schwächeren Sturmes als „Katrina“ hatte eine Flutkatastrophe vorhergesagt. Politiker auf allen Ebenen wussten davon. Mehr noch – die Katastrophenschutzbehörde Fema und Präsident George Bush wurden in den Tagen vor „Katrina“ informiert, dass die Dämme vermutlich überspült werden würden.
Doch selbst als das Wasser schon in den Straßen stand, wurde „Katrina“ nicht ernst genommen. „Niemand in der Regierung begriff, was es bedeutet, wenn eine Stadt zu 80 Prozent unter Wasser steht“, sagte später der Historiker Doug Brinkley. George Bush hielt in Kalifornien ein Rede, in der er seine Erfolge in Irak bewarb. Sein Vizepräsident Dick Cheney war in Wyoming zum Angeln. Außenministerin Condoleeza Rice wurde dabei gesehen, wie sie in New York shoppen ging und abends ein Musical besuchte. Und bei Fema-Direktor Michael Brown kam seine ganze Inkompetenz zum Vorschein. Brown war vor seiner Benennung ein Lobbyist der Ölindustrie und wurde von Präsident Bush aus Gefälligkeit auf einen Posten gehoben, den dieser für unwichtig hielt.
Michael Chertoff, Direktor der Heimatschutzbehörde, brauchte derweil vier Tage, um Hurrikan „Katrina“ zu einem Notfall von nationaler Tragweite zu ernennen und somit die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren. In Louisiana stritten sich derweil der Bürgermeister und die Gouverneurin darüber, wer Befehlsgewalt über die Nationalgarde habe.
„Arroganz der Macht“
Die Gründe für die Gleichgültigkeit, die Apathie und die Empathielosigkeit der Politik auszumachen, war nicht schwer. Der große Bürgerrechtler Harry Belafonte sprach von „der Arroganz der Macht“, die damit zu tun habe, dass die betroffenen Menschen „ökonomisch und rassisch“ irrelevant waren. New Orleans wurde vor „Katrina“ zu 67 Prozent von Afroamerikanern bewohnt. Gleichzeitig war es die sechstärmste Stadt der USA.
Der Zynismus der Mächtigen fand seinen prägnantesten Ausdruck in den Worten von George Bushs Mutter Barbara, als sie in einer Notunterkunft in Texas die durch den Sturm heimatlos gewordenen Menschen besuchte. Für sie, so Bush, sei „Katrina“ doch ein Glücksfall gewesen, gehe es ihnen doch jetzt schon besser als in der Stadt, in der sie seit Generationen verwurzelt gewesen waren. So sah auch die Evakuierungspolitik aus: Die Menschen wurden wahllos über das Land verteilt, Familien wurden auseinandergerissen. Der Autor Michael Henry Dyson sah schmerzliche Parallelen zur Sklaverei.
Vorschau auf die USA unter Donald Trump
Im Rückblick kann man nun nicht umhin, „Katrina“ als Vorschau auf das zu betrachten, was sich heute in den USA abspielt. Präsident Donald Trump möchte die Katastrophenschutzbehörde Fema ganz abschaffen und den Bund aus der direkten Verantwortung für die Bürger herausnehmen – gerade so, wie er es mit dem Abbau oder der Aushöhlung beinahe aller Bundesbehörden versucht. Der Zynismus und die Gleichgültigkeit gegenüber den Bürgern, insbesondere den Ärmsten und Schwächsten, kommt darin ebenso zum Ausdruck wie in seinem Umverteilungsprogramm von unten nach oben. Noch unverhohlener und schamloser als je zuvor werden die Schwächsten des Landes einfach zurückgelassen.
Trotzdem konnte ich aus jenen finsteren Wochen vor 20 Jahren etwas aus New Orleans mitnehmen, das Hoffnung macht. Etwas mehr als eine Woche nach dem Sturm spielte in einem Club in Baton Rouge, rund 80 Kilometer von New Orleans entfernt die Dirty Dozen Brass Band – eine energische Bläsertruppe aus New Orleans, die traditionellen Dixie mit Funk verband.
Das Publikum bestand mehrheitlich aus Menschen, die New Orleans hatten verlassen müssen, die nicht wussten, ob sie noch ein Heim haben oder ob ihre Stadt jemals wieder auferstehen würde. Und doch feierten sie an diesem Abend ausgelassen: dass sie überlebt hatten, ihre Tradition und ihre Kultur, die weiterleben würde und das Leben selbst. Es war eine Demonstration jener Resilienz, die Afroamerikaner im Angesicht von unerträglichen Härten über Jahrhunderte eingeübt haben. Manche nennen es den Blues, nicht nur als Musikgattung, sondern als Lebenseinstellung. Es ist eine Einstellung, die heute nützlicher scheint denn je.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
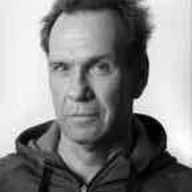




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!