Buch über Rassismus und Antisemitismus: Keine neuen Grenzen ziehen
Im Fokus in „Frenemies“: die Beziehung zwischen Antisemitismus und Rassismus. Der Sammelband erlaubt das Herantasten an unbequeme Haltungen.
Am Anfang steht das Scheitern. In der Einleitung ihres Sammelbands gewähren die Herausgeber*innen Saba-Nur Cheema, Sina Arnold und Meron Mendel einen Einblick in den Entstehungsprozess von „Frenemies. Antisemitismus, Rassismus und ihre Kritiker*innen“. Als die Namen zweier Autoren bekannt wurden, die im Buch vertreten sein sollten, wollten andere ihre Texte zurückziehen.
Am Ende landeten einige geplante Texte nicht im Band. Arnold, Cheema und Mendel schreiben: „Damit sind wir unserem eigenen Anspruch nicht nachgekommen, auch palästinensischen Stimmen mehr Gehör zu verschaffen. Außerdem ist unser Versuch, die gängige Praxis der Kontaktschuld mit diesem Sammelband zu kritisieren, an dieser Stelle gescheitert.“
„Frenemies“ soll Konflikte abbilden, die in der Beziehung zwischen Antisemitismus und Rassismus auftreten, um konstruktiven Streit zu ermöglichen. Texte von über 50 Autor*innen aus den Bereichen Wissenschaft, politischer (Bildungs-)Arbeit, Medien und dem Kunstbetrieb sind versammelt.
Angeordnet sind sie durch kurze Fragen wie: „Ist Antisemitismus eine Form von Rassismus?“ „Ist Kritik am Islam rassistisch?“ „Gibt es Konkurrenz in der Erinnerung an den Holocaust und Kolonialismus?“
Antisemitismuskritik und Postkolonialismus
Vor allem Antisemitismuskritik und Postkolonialismus stehen im Konflikt zueinander, der immer wieder in einer Diskussion über die Haltung zu Israel mündet. Viel zu oft entsteht dabei der Eindruck, es gebe zwei klar abgegrenzte, konkurrierende Gruppen. Ja, es gebe Grenzen, schreiben die Herausgeber*innen, aber auch über diese müsse gestritten werden.
Meron Mendel, Saba-Nur Cheema, Sina Arnold (Hg.): „Frenemies. Antisemitismus, Rassismus und ihre Kritiker*-innen.“ Verbrecher Verlag, Berlin 2022, 350 Seiten, 20 Euro
So verschieden die Positionen, so vielstimmig der Klang der Texte: Überwiegend ist man bemüht um Sachlichkeit, manche Autor*innen schreiben jedoch nachdrücklich parteilich, hin und wieder emotional persönlich.
Leser*innen können wählen, mit welchen Argumenten sie sich auseinandersetzen wollen. Hilfreich sind dabei kontextualisierende Texte zu Beginn des Sammelbands, in denen Antisemitismus und Rassismus in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden, historisch und in ihren Ausdrucksformen betrachtet werden.
Der Sammelband erlaubt das Herantasten an Haltungen, die der eigenen unbequem sind. Ein Appell taucht dabei in den Texten immer wieder auf: Bei allen Schwierigkeiten müssten Menschen, die Antisemitismus und die, die Rassismus entgegentreten, zusammenarbeiten, um die Gesellschaft besser zu machen.
Wenn Interessierte, die sich als Gegenspieler*innen verstehen, diesen Appell vernehmen und das gleiche Buch in die Hand nehmen, ist das Scheitern am Ende vielleicht ein Schritt hin zum besseren, streitenden Gespräch.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





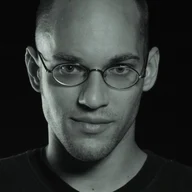
meistkommentiert