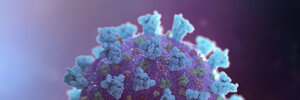Überleben in Irakisch-Kurdistan: Viele Helfer gehen
In Lagern rund um Halabja in Irakisch-Kurdistan leben 20.000 Geflüchtete. Für Corona sei die Region nicht gerüstet, sagt Journalist Qayssar Rahman.

Sicherheitsbeamte kontrollieren die Straßen in Sulaimaniya Foto: Ako Rasheed/reuters
20.000 Menschen, die vor dem IS-Terror im Irak und dem Krieg in Syrien geflohen sind, leben jetzt in Lagern rund um die Stadt Halabja in Irakisch-Kurdistan. Bisher gibt es unter ihnen keine bestätigten Corona-Infektionen. „Noch“, sagt der Journalist Qayssar Rahman. „Aber immer mehr Menschen haben kein Geld, um Milch oder Mehl zu kaufen.“
Eigentlich leitet er 43-jährige Familienvater seit Jahren die Nichtregierungsorganisation NWE Dangi, die ein unabhängiges Community Radio betreibt und sich für Frauenrechte und Umweltschutz einsetzt. Doch die Coronakrise hat seinen Alltag drastisch verändert. Morgens streift er Mundschutz, Handschuhe und einen Schutz-Umhang über und verlässt das Haus – als einer der wenigen 80.000 Einwohner von Halabja. Denn es gilt auch hier eine Ausgangssperre, Betriebe und Schulen sind geschlossen.
Ende Februar wurde die erste Corona-Infektion in der benachbarten Stadt Sulaimanija bekannt. Als die Regionalregierung von Irakisch-Kurdistan wenig später zahlreiche Ge- und Verbote erließ, gründete Rahman mit vier Freunden die Gruppe „Civil Resistance Campaign against Coronavirus in Halabja Province“.
Auf einer neuen Facebook-Seite riefen sie zur Mitarbeit auf. Inzwischen sind 30 Menschen dabei: „Wir gehen in die Moscheen und fahren mit einem Lautsprecher-Wagen durch den Ort und die Provinz. Und wir bitten die Leute, zu Hause zu bleiben, Abstand zu halten und auf Hygiene zu achten“, berichtet Rahman. Aufklärung sei nötig, noch immer hielten viele Menschen Vorsichtsmaßnahmen für überflüssig. Mit einem speziellen Programm wendet NWE Dange Radio sich vor allem an Geflüchtete.
NGOs mussten Arbeit einschränken
Die Aktionen sollen helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Unser Gesundheitssystem ist schon in normalen Zeiten nicht ausreichend und jetzt nur sehr schlecht gerüstet.“ Wohl deshalb waren die örtlichen Behörden über das Angebot der Gruppe erfreut und erteilten den freiwilligen Helfern offizielle Genehmigungen, sodass „wir nicht von der Polizei angehalten und dann nach Hause geschickt werden“.

Hilft, wo er kann: Qayssar Rahman Foto: privat
Doch infolge des Lockdowns verschlechtert sich die Lage zusehends. Viele Hilfsorganisationen, die sich bislang um arme Menschen und Geflüchtete aus Syrien und dem Irak gekümmert haben, mussten ihre Arbeit einschränken. „Niemand kann die Mitarbeiter zwingen zu arbeiten“, so Rahman; einige Helfer haben das Land verlassen. Noch schlimmer sind die Folgen für Tausende Geflüchtete, die als Tagelöhner in Betrieben oder auf den Feldern gearbeitet haben. Jetzt sind sie arbeitslos, oft ohne jedes Einkommen.
Wie schwierig für viele das (Über-)Leben geworden ist, erfahren Rahman und seine Mitstreiter täglich bei ihren Rundgängen, von Anrufern oder über ihre Facebook-Seite: „Anfangs haben wir selbst Geld und Lebensmittel gegeben und nur wohlhabende Leute gefragt. Aber jetzt werden es immer mehr, die Hilfe brauchen. Wir fragen Vermieter, ob sie die Miete stunden können, und wir bitten Supermärkte, Firmen und reiche Familien um Spenden.“