Videospiel-Serie „Yakuza: Like a Dragon“: Surreale Missionen und japanischer Humor
Das erfolgreiche Videospiel „Yakuza: Like a Dragon“ wurde als TV-Serie adaptiert. Warum ihre Bilder- und Erzählwelt jedoch nur halb so gut ist.
Kunstvolle Rückentattoos, Glücksspiel, Prostitution und Alkohol, rivalisierende Gangs, ein familiärer Ehrenkodex. Die Welt der Yakuza ist Schauplatz in vielen Medien. Ihre Darstellung ist oft kitschig und romantisiert. Während sich im Westen eine ganze Mediensparte nur mit Königshäusern und dem Klatsch dahinter beschäftigt, gibt es dieses Pendant auch für die Yakuza. Neben den berühmten Filmen von Takeshi Kitano gibt es Magazine, die sich auf die Mafia spezialisieren.
Einer der größten Exportschlager ist die Videospielreihe „Yakuza: Like a Dragon“, die seit 2005 über 20 Spiele hervorgebracht hat. Die Reihe findet nun in der Amazon-Serie „Like a Dragon: Yakuza“ eine Umsetzung. Sie fängt den Charme der Vorlage nur bedingt ein.
Im Mittelpunkt steht – wie in den meisten Spielen – der junge Kazuma Kiryu (Ryoma Takeuchi). Bei einem Raubüberfall bestiehlt er die skrupellosen Yakuza, woraufhin deren Oberhaupt ihn und seine Freunde umbringen will. Stattdessen bittet Kiryu um Aufnahme in die Yakuza-Familie.
Die Serie springt zu einem erwachsenen Kiryu, der in einen Yakuza-Krieg hineingezogen wird. Rückblenden kehren immer wieder zu einem unerfahrenen Kiryu zurück, der sich erst sein markantes Rückentattoo verdienen muss.
„Yakuza: Like a Dragon“, ab sofort zu sehen auf Amazon Prime Video
Weder bei den Spielen noch der Serie sollte man eine differenzierte Auseinandersetzung mit organisierter Kriminalität erwarten. Die Spiele sind bunte, dramatische Soap Operas mit einem japanischen, für den Westen nicht immer zugänglichen Humor. Sie warten mit surrealen Missionen auf, wie ein Tanzduell mit einem Michael-Jackson-Imitator in einer nachgestellten Zombie-Apokalypse.
Viele originalgetreue Schauplätze
Die überschaubare, aber detailverliebte Spielwelt lockt mit allerlei Nebenaufgaben. In Kartrennen, Darts, Wrestling oder der Management-Simulation eines Nachtclubs kann man Hunderte von Stunden investieren, ohne die Haupthandlung zu beginnen, meist eine Mischung aus überstilisierter Melodramatik und ernsthaften Inhalten über Macht, Korruption und das Leben in einer wachsenden Metropole.
In der Serie findet man viele originalgetreue Schauplätze aus den Spielen, allen voran der fiktive Tokio-Stadtteil Kamurocho. Für die Spieler:innen fühlt es sich wie eine Rückkehr an, Neulingen wird sich der Reiz des bunten Viertels kaum erschließen. Es fehlen die Interaktivität, die Minispiele und verrückten Aufgaben, die die Umgebung lebendig und greifbar machen. Das können auch die gut gewählten Darsteller:innen nicht kompensieren.
Während den sechs Episoden stellt man sich unweigerlich die Frage, ob die Serie überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Erst recht, wenn die Spiele bereits wie abgeschlossene Staffeln funktionieren.
Jedes „Yakuza“ steht für sich, wartet mit mehreren Stunden hochwertig inszenierten Zwischensequenzen auf, wilden und doch divers geschriebenen Charakteren und obendrein noch zig Stunden an interaktivem Spielspaß. Was braucht es da eine Serie?
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

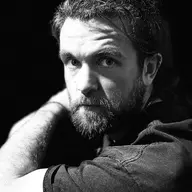




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!