Schutz vor polizeilichen Lockspitzeln: Tatprovokation ist rechtswidrig
Ein Berliner wurde zum Kauf von 97 Kilo Kokain gedrängt. Nun rät Karlsruhe zum Verwertungsverbot der Aussagen von „Agents Provocateurs“.
FREIBURG taz | Wenn Unschuldige von polizeilichen Lockspitzeln zu Straftaten verführt werden, sollen die Aussagen der Spitzel vor Gericht nicht verwertet werden. Das empfiehlt das Bundesverfassungsgericht in einem jetzt bekannt gemachten Kammerbeschluss.
Im konkreten Fall war ein Berliner Cafébetreiber in Verdacht geraten, er handele mit Drogen. Die Polizei setzte daraufhin einen V-Mann auf ihn an, dem neben einer Tagespauschale auch eine Erfolgsprämie versprochen wurde. Der V-Mann lockte und drängte den Gastronomen deshalb eineinhalb Jahre lang, bis dieser tatsächlich 97 Kilogramm Kokain aus Südamerika orderte. Bei der Entgegennahme der Ware wurde der angestiftete Drogenhändler dann festgenommen.
Das Landgericht Berlin entschied zwar, dass hier eine rechtsstaatswidrige „Tatprovokation“ vorlag. Es milderte die Strafe des Cafébetreibers deshalb um mehr als die Hälfte, verurteilte ihn aber immer noch zu vier Jahren und fünf Monaten Haft. Dagegen erhob der Mann Verfassungsbeschwerde und forderte einen Freispruch. Ein derartiger Einsatz von Lockspitzeln, auch „agents provocateurs“ genannt, stelle ein Verfahrenshindernis dar.
Karlsruhe betonte nun: „Die Ermittlungsbehörden sollen Straftaten verfolgen, nicht sie verursachen.“ Eine Verfahrenseinstellung komme aber nur in „extremen Ausnahmefällen“ in Betracht, etwa wenn ein gänzlich Unverdächtiger zu Taten überredet wird. Der Gastronom sei aber schon verdächtig gewesen und habe im Laufe der Zeit durchaus eigenen Tatantrieb entwickelt. Deshalb genüge hier eine Strafminderung. Die Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt.
Am Ende ihres Beschlusses empfahlen die Karlsruher Richter aber erstmals, in solchen Fällen die Aussagen der Lockspitzel vor Gericht nicht zu verwerten. Sie greifen damit ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Oktober 2014 auf.
Im Berliner Fall kam es auf ein Verwertungsverbot freilich nicht an, weil der Gastronom und seine Mittäter Geständnisse abgelegt hatten. Das Berliner Landgericht musste die Aussagen des Lockspitzels also gar nicht gegen den Angeklagten verwenden.
Az.: 2 BvR 209/14
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








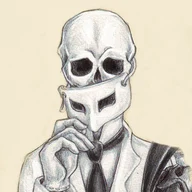
meistkommentiert