Präsident des Zentralrats der Juden: „Der latente Antisemitismus ist hoch“
Beim Kampf gegen Rassismus müssen Juden und Muslime zusammenarbeiten, sagt Josef Schuster. Ein Gespräch über Familie, Pegida und die Linkspartei.

taz: Herr Schuster, wie fühlt es sich so an als neuer Präsident des Zentralrats der Juden?
Josef Schuster: Im Moment noch ein bisschen gestresst. Geändert hat sich, dass ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehe. Was auch bedeutet, dass ich die Termine, die ich wahrnehme, nicht mehr so ganz alleine wahrnehme. Daran muss man sich erst gewöhnen.
Was meint: Sie erhalten jetzt einen besonderen Personenschutz.
Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir solche Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr brauchen. Mein größter Wunsch wäre es, wenn keine Polizeistreifenwagen vor jüdischen Kindergärten, Schulen, Gemeindezentren und Synagogen stehen müssten. Auch ich würde mich ohne Personenschutz erheblich wohler fühlen. Ich meinte allerdings auch, dass jetzt jeder Termin, bei dem ich auftauche, erheblich mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfährt als früher.
Der 60-jährige Arzt ist seit dem 30. November Präsident des Zen- tralrats der Juden in Deutschland. Der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken, die Vater David ab Mitte der fünfziger Jahre wiederaufgebaut hat, steht er seit 1998 vor. Der Zentralrat ver- tritt 108 jüdische Gemeinden mit etwa 101.300 Mitgliedern.
Neben dem ehrenamtlichen Amt wollen Sie weiter in Ihrer Würzburger Praxis als Internist arbeiten. Wird da jetzt jeder Patient kontrolliert?
Es wird jetzt hier keiner vorher abgetastet. Da haben die Sicherheitsbehörden einen Weg gefunden, der die Patienten überhaupt nicht belästigt, aber doch ein gutes Maß an Sicherheit bietet.
Haben Sie überhaupt noch Zeit für Ihren Beruf?
Zum Glück ist das bei einer Bestellpraxis etwas einfacher zu handhaben. Es geht um diagnostische Untersuchungen, bei mir um Spiegelungen im Magen-Darm-Trakt. Da kann man die Patienten gezielt bestellen. Bei einer Praxis eines Allgemeinmediziners, wo Sie eigentlich überhaupt nicht wissen, wer und wie viele Patienten am Tag kommen, wäre es sehr schwierig. Ansonsten ist der Zentralrat ja kein Einmannbetrieb. Ich habe hochkompetente Stellvertreter, auf deren Unterstützung ich baue.
Pflegen Sie einen anderen Führungsstil als Ihr Vorgänger Dieter Graumann?
Ich glaube nicht. Wir beide haben sehr harmonisch zusammengearbeitet. Das hängt damit zusammen, dass wir in den Grundgedanken sehr wenige Unterschiede haben. Wo es ausnahmsweise mal ein Problem gab, haben wir das intern diskutiert und eine Konsenslösung gefunden. Ich will Dieter Graumanns Weg fortsetzen.
Sie beide gehören zur Nachkriegsgeneration, die die Schoah nicht mehr selbst miterleben musste. Resultiert daraus ein anderer Blick auf Deutschland, als ihn beispielsweise Ignatz Bubis oder Charlotte Knobloch hatten?
Der Unterschied ist, dass die Generation, die nachgeboren ist, sicherlich einen etwas anderen, unbefangeneren Blick auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft hat. Das ergibt sich aus der Natur der Sache.
Ihre Familie ist Mitte der 1950er Jahre aus Israel zurückgekehrt. Da waren Sie zwei Jahre alt. Was hat Ihre Eltern dazu gebracht, ins Land der Täter zu ziehen?
Das war dem Wunsch des Großvaters geschuldet. Er hatte sich seinen zwangsarisierten Grundbesitz im unterfränkischen Brückenau rückübereignen lassen und wollte diesen wieder verwalten. Von Israel aus war das nicht möglich. Was in meinem Elternhaus anders war als in vielen anderen jüdischen Elternhäusern: Ich bin nicht mit dem Gedanken aufgewachsen, dass wir nur vorübergehend in Deutschland leben und irgendwann wieder nach Israel, nach Amerika oder sonst wohin ziehen. Ich wurde so erzogen, dass ich bewusst in Würzburg lebe.
Wie schwer ist Ihrer Familie die Rückkehr gefallen?
Meiner Mutter ist sie schwerer gefallen. Ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Einer der schwersten Momente, so hat sie mir erzählt, sei gewesen, als sie 1956 in München aus dem Flugzeug gestiegen ist und deutsche Uniformen gesehen hat. Das war sehr hart für sie. Die Vergangenheit wurde nie bei uns ausgeblendet. Wenn es zu dem Thema kam, wurde darüber gesprochen. Sie war aber auch nicht das Thema Nummer eins. Nicht bei jedem Frühstück, Mittagessen, Abendessen wurde über den Holocaust geredet.
Die Eltern Ihres Vorgängers Graumann änderten mit der Einschulung seinen Vornamen von David in Dieter, damit er nicht als Jude auffällt. Wie war das bei Ihnen?
Alle meine Mitschüler und auch die Lehrer wussten, dass ich Jude war. Es war nicht mein erster Satz: Hallo, ich bin Josef und ich bin jüdisch. Aber das habe ich nie verborgen, und es war auch niemals ein Problem.
Ihr Sohn ist CSU-Stadtrat in Würzburg. Auch Sie gelten als politisch konservativ. Eine zutreffende Charakterisierung?
Ich glaube auch, dass ich ein eher konservativ denkender Mensch bin. Aber ich habe kein Parteibuch. Ich finde auch gut, dass ich keins habe. Für mein Amt ist das eigentlich besser, weil ich es wichtig finde, offen mit allen demokratischen Parteien reden zu können.
Aber eine Parteipräferenz dürften Sie doch schon alleine familienbedingt haben, oder?
Ich gehöre zu jenen Menschen, die man als Wechselwähler bezeichnet. Mit einer Ausnahme habe ich allen momentan im Bundestag sitzenden Parteien schon mal meine Stimme gegeben. Das gilt auch für eine Partei, die aktuell nicht mehr dort sitzt.
Die einzige Ausnahme dürfte die Linkspartei sein.
Ja, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass ich mit Vertretern dieser Partei nicht rede. Mit Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau habe ich mich erst kürzlich sehr gut unterhalten. Dass es Mitglieder der Linkspartei gibt, und zwar wohl mehr als in anderen Parteien, deren Wortwahl beispielsweise im Israel-Gaza-Konflikt nicht immer ganz glücklich war, steht auf einem anderen Blatt.
Wie haben Sie die antiisraelischen Proteste im vergangenen Sommer empfunden?
Kritische Äußerungen zur Politik Israels sind etwas ganz Legitimes. Nur wenn diese Kritik umschlägt mit Worten wie „Kindermörder Israel“ oder „Juden in das Gas“, dann offenbart sich hinter dieser vermeintlichen „Israelkritik“ purer Antisemitismus. Das fand ich in dem Ausmaß erschreckend.
Sie sind in Israel geboren. Wie ist Ihr Verhältnis zu dem Land?
Zum einen habe ich Verwandtschaft in Israel. Ein Cousin und eine Cousine mit Familie leben in Haifa. Zum anderen ist für jeden Juden das Verhältnis zu Israel nicht neutral. Einfach deshalb: Hätte es den Staat Israel in den 1930er Jahren gegeben, wäre es nicht zu dem gekommen, wozu es gekommen ist. Denn Israel ist eine sichere Zufluchtsstätte für alle Juden auf der Welt. Aufgrund der historischen Erfahrung gilt das erst recht für jüdische Menschen in Deutschland.
Was bedeutet das für Ihre Tätigkeit als Zentralratspräsident?
Dass es eine besondere Affinität zu Israel gibt, ist unzweifelhaft. Aber ich möchte weder in persona noch als Vertreter der Institution Zentralrat als eine Konsularstelle der israelischen Botschaft gesehen werden. Ein offizieller Vertreter des Staates Israel bin ich nicht.
Sie gehören einer orthodoxen Gemeinde an, vertreten als Zentralratspräsident aber auch liberal orientierte Gemeinden. Ist das für Sie kein Problem?
Der Zentralrat ist die politische Vertretung aller in Deutschland lebenden Juden, unabhängig von deren religiöser Prägung. Mir ist die Vielfalt in der Einheit wichtig. Das gilt nicht nur für den Zentralrat, sondern auch die einzelnen Gemeinden. Nun sind wir in Würzburg mit knapp 1.100 Mitgliedern eine recht kleine Gemeinde. Da sind Unterteilungen kaum sinnvoll. Dass innerhalb unseres Gemeindezentrums die Religionsgebote streng beachtet werden, ist die Klammer, unter der alle Juden hier ins Haus kommen können, ob sie darauf Wert legen oder nicht. Für größere Gemeinden stellt sich die Frage anders. Da finde ich es gut, wenn unter dem Dach der Einheitsgemeinde die verschiedenen Strömungen des Judentums ihren eigenständigen Platz finden. Das Idealbild ist für mich Frankfurt: In der Synagoge im Westend findet sowohl ein orthodoxer als auch ein liberaler Gottesdienst mit einer Rabbinerin statt. Allen Unkenrufen zum Trotz hält das gemeinsame Dach.
Welche Herausforderungen sehen Sie für die nächste Zeit?
Ich befürchte, dass in der Bundesrepublik das Thema Fremdenfeindlichkeit weiter leider ein ernstes bleibt. Stichwort Pegida in Dresden. Auch wenn sich diese Demonstrationen vorgeblich gegen Islamisierung richten, ist das nichts anderes als Fremdenfeindlichkeit. Diese generalisierende Abwertung von Muslimen, damit habe ich ein großes Problem.
Werden Sie das Gespräch mit den muslimischen Verbänden suchen?
Es gab und gibt einen Dialog. Beim Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben wir ein gemeinsames Interesse. Allerdings gibt es den von uns immer wieder geäußerten Wunsch an die muslimischen Verbände, sich auch in den eigenen Reihen aktiv gegen Antisemitismus einzusetzen. Gerade unter muslimischen Jugendlichen ist das ein großes Problem. Die Umsetzung dieses Wunsches ist mir bislang noch nicht so richtig offensichtlich geworden. Das macht die Zusammenarbeit nicht ganz leicht.
Für wie groß halten Sie das Problem des Antisemitismus in Deutschland?
Der latente Antisemitismus in der Gesellschaft ist immer noch erschreckend hoch. Laut der verschiedensten Studien hat jeder fünfte bis vierte Deutsche antisemitische Vorurteile – und das vor allen Dingen in Regionen, wo es überhaupt keine Juden gibt. Es gibt offenkundig historische Traditionen, die über die Großeltern und die Eltern von Generation zu Generation weitergegeben werden. Kein Kind wird mit antisemitischen Vorurteilen geboren.
Ihre Vorgänger haben sich stets auch als Mahner gesehen. Sehen Sie darin auch Ihre Rolle?
Ich hoffe, nicht zu häufig Mahner sein zu müssen. Aber selbstverständlich werde ich meine Stimme erheben, wenn es angesichts von Antisemitismus, Rassismus und Israelhass wichtig ist.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






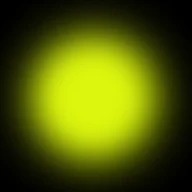







meistkommentiert
Günstiger und umweltfreundlicher
Forscher zerpflücken E-Auto-Mythen
Nach tödlichen Polizeischüssen
Wieder einmal Notwehr
Probleme bei der Deutschen Bahn
Wie absurde Geldflüsse den Ausbau der Schiene bremsen
Attentat an israelischen Diplomaten
Mörderische Selbstgerechtigkeit
NRW-Grüne Zeybek über Wohnungsbau
„Es muss einfach leichter werden, mehr zu bauen“
Krieg im Gazastreifen
Netanjahu fordert Vertreibung der Palästinenser