Kriegsalltag in der Ukraine: Vier Koffer im Hauseingang
Im ukrainischen Charkiw sind jede Nacht Schüsse und Explosionen zu hören. Die Menschen auf dem Land haben es da besser – aber wie lange noch?

Sofort nach dem Frühstück rufe ich eine ukrainische Kollegin an, frage sie, ob sie mir nicht ein Hotel empfehlen kann, wo es nachts etwas weniger Einschläge gibt. Kann sie. „Sie haben Glück gehabt“, sagt sie. „dass sie die Explosion gehört haben. Im Epizentrum hört man das nicht.“ Und berichtet dann, dass unter den über 20 Toten dieser Nacht auch Taubstumme in einem Wohnheim waren, die die Sirenen auch nicht gehört haben.
Tagsüber scheint die Stadt so wie sie immer war. Im Park sitzen Menschen auf den Bänken, einige turnen auf den Sportgeräten, die Blumen und der Rasen sind wunderbar gepflegt. Angestellte des Gartenamtes fegen sorgfältig die Wege.
Nur eine Sache ist anders als bei meinem letzten Besuch der Stadt im Februar: es sind kaum Menschen unterwegs. Und wenn man Gesprächsfetzen mitbekommt, hört man immer wieder ein Wort: Explosion. Mal auf ukrainisch, mal auf russisch. Ähnlich auch die Situation auf dem Bahnhof und in der U-Bahn. Alles fährt, die U-Bahn sogar kostenlos. Doch es sind nur sehr wenige Menschen unterwegs, die meisten Kioske geschlossen. Eine Stimmung wie Sonntag morgen um fünf Uhr.
Ihr Problem: die nahe Front
Mein neues Hotel ist besser, hier höre ich nachts die Einschläge nicht mehr in dieser Intensität. Während Charkiw jede Nacht mehrfach beschossen wird, haben es die Bewohner der umliegenden Dörfer und Kleinstädte leichter, werden sie doch seltener beschossen.
Switlana und Ihor haben es geschafft. Die Landwirte haben in der Kleinstadt Smijiw ein schönes Anwesen mit einem riesigen Garten, zwei großen Häusern und einem kleinen Teich. Hier wohnen sie mit ihren Kindern und Enkelkindern. Geld scheint nicht ihr Problem zu sein. In jedem Zimmer ein großer Bildschirm, auf dem Dachgeschoss seines Hauses hat sich der Sohn einen Billardtisch eingerichtet.

In seiner Freizeit geht Ihor gerne im nahegelegenen Fluss angeln. Richtig dicke Fische habe er schon an Land gezogen, erzählt er stolz. Doch die Familie hat ein Problem: Die Front ist nur 20 Kilometer weit weg. Und weil das so ist, stehen vier Koffer am Hauseingang. Da ist alles drin, was man für eine Flucht braucht, erklärt Switlana.
Doch zunächst mal bleibt die Familie hier, arbeitet unter schweren Bedingungen weiter. Vor einem Jahr habe er noch 250 Dollar für die Tonne Getreide erhalten, jetzt sind es nur noch 130 Dollar, erklärt Ihor. Gleichzeitig ist die Produktion teurer geworden. Benzin kostet jetzt zwei Dollar und nicht einen, wie im letzten Jahr, für den Dünger bezahlt er jetzt 800 Dollar die Tonne und nicht 400.
Angst vor dem Jubiläumstag
Regelmäßig fahren die HNO-Ärztin Anna Klistina und ihr Mann Dima Klistin, ein Unternehmer in der IT-Branche, in schusssicherer Weste und vollbeladen mit Lebensmitteln und Medikamenten an die Front. Dort gibt es eine Brücke, die schon so von Schüssen beschädigt ist, dass man sie nur noch zu Fuß überqueren kann. Hier halten sie an. Ihnen kommen Freunde von der anderen Seite entgegen, übernehmen die Lieferung, um sie dann später in der Bevölkerung der russisch besetzten Gebiete zu verteilen. Von den Behörden beider Seiten werden diese Hilfsaktionen geduldet.
Anna und Dima sind nicht die einzigen, die diesen offiziell nicht existierenden Übergangspunkt nutzen. Eine weitere Frau, die ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen möchte, ist hier aktiv. Sie organisiert den Austausch von gefangenen Zivilisten. Und an dieser Brücke überqueren Menschen, die noch am selben Tag in einem Keller des russischen Geheimdienstes festgehalten worden waren, die Frontlinie.
Heute spricht alles in Charkiw vom 24. August. Das ist nicht nur der ukrainische Unabhängigkeitstag. An diesem Tag ist der Krieg genau sechs Monate alt und die Befürchtungen in Charkiw sind groß, dass Russland diesen Tag mit einer weiteren Grausamkeit begehen könnte.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





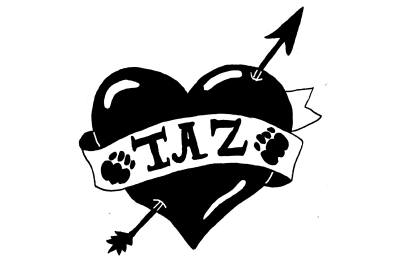
meistkommentiert
+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++
Moskau fordert für Frieden vollständigen Gebietsabtritt
Sozialwissenschaftlerin zur Spargelernte
„Er sagte: ‚Nirgendwo war es so schlimm wie in Deutschland‘“
Kontroverse um Gedenkveranstaltungen
Ein Kranz von Kretschmer, einer von Putin
Mindestlohn
Die SPD eiert herum
Tödlicher Polizeieinsatz in Oldenburg
Drei Schüsse von hinten
„Friedensplan“ der US-Regierung
Putin wird belohnt, die Ukraine aufgegeben