Klimaplan für Hamburg: Koalitions-Kampf um Klimakrone
Hamburgs rot-grüner Senat legt Landesklimaplan vor. Auch 55 Prozent weniger CO2 verbessern das Klima zwischen den Koalitionären nicht.

Die Inszenierung liegt exakt zwischen Waldorf und Statler, den beiden Opis aus der Muppet -Show, und Loriots „Ein Ehepaar erzählt einen Witz“. Wird Bürgermeister Tschentscher etwas gefragt, muss auch Umweltsenator Kerstan eine Antwort geben. Und geht die Frage an Kerstan, setzt es natürlich einen Co-Kommentar des Bürgermeisters.
Der legt Wert darauf, dass in Hamburg erst seit 2011, seit die SPD wieder in Hamburg regiert, pro Jahr 400.000 Tonnen CO2 eingespart wurden, während davor – also unter Schwarz-Grün – die Bilanz dürftig ausfiel. Kerstan kontert damit, dass das zu kurz gesprungene Klimaschutzprojekt des Bundes und die den Windkraftausbau lahm legenden Abstandsregelungen – Projekte der Großen Koalition im Bund also – Hamburgs Klimaziele gefährdeten. So wahlkämpfen sich der Bürgermeister und sein Umweltsenator durch ihr neues Klimaschutzgesetz.
Das hat auch Inhalte zu bieten: Um 55 Prozent gegenüber 1990 soll der Hamburger CO2 -Ausstoß bis 2030 sinken, bis 2050 soll die Stadt ganz klimaneutral sein. Dabei setzt der Senat auf über 400 Einzelmaßnahmen und darauf, dass der Kohleausstieg auf Bundesebene wie geplant vorankommt. Die größte Einzelmaßnahme dabei ist die längst beschlossene und immer wieder verschobene Abschaltung des Kohlekraftwerks Wedel 2025 und die Umstellung der Hamburger Fernwärmeproduktion auf erneuerbare Energien, Abwärme und Erdgas.
Die Abschaltung des Kraftwerks Wedel bringt am meisten
Nicht in die Berechnung ein fließt das Kohlekraftwerk Moorburg, da es zwar auf Hamburger Grund und Boden steht, Strom aber für die ganze Republik produziert. Neben einer umweltfreundlicheren Fernwärmeproduktion spielt die „Mobilitätswende“ mit einem massiven Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Elektrifizierung von Fahrzeugflotten eine zentrale Rolle.
Große statistische Effekte kann auch die Industrie erzielen, wenn energieintensive Betriebe wie die Hamburger Stahlwerke auf klimaneutralen Ökostrom umsteigen. Auch der Ausbau der Landstromversorgung für Container- und Kreuzfahrtschiffe steht auf dem Programm.
Das neue Klimaschutzgesetz soll zudem neue Energiestandards zur Pflicht machen. So schreibt es eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen auf Neubauten fest, soweit diese im konkreten Fall ökonomisch vertretbar ist. Ölheizungen im Neubau soll es bereits ab 2022 nicht mehr geben; vier Jahre später dürfen sie auch beim Austausch bestehender Anlagen nicht mehr eingebaut werden. Gebäude der öffentlichen Hand müssen nach einem erhöhten Energieeffizienzstandard errichtet und saniert werden, die Landesverwaltung samt ihres Fuhrparks sollen bis 2030 klimaneutral organisiert sein.
Während Bürgermeister Tschentscher sicher ist, mit den beschlossenen Maßnahmen die selbst gesetzten Klimaziele locker zu erreichen, glaubt Kerstan ganz unbescheiden „dass ich und meine Behörde das anspruchsvollste und weitreichendste Klimaschutzgesetz vorgelegt haben“.
Das sehen die Opposition und die Naturschutzverbände naturgemäß ganz anders. CDU-Umweltpolitiker Stephan Gamm kritisiert vor allem, dass das rot-grüne Klimapaket aus „vielen Verboten und neuen teuren Vorschriften“, etwa beim Wohnungsbau, bestehe, die dafür sorgen würden, „dass das Leben in Hamburg deutlich teurer wird“
Für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hingegen steht der rot-grüne Klimaplan „auf wackligen Füßen“. Hamburgs BUND-Chef Manfred Braasch: „Wesentliche CO2 -Einsparungen sind nicht ausreichend hinterlegt, vieles wirkt optimistisch ins „Blaue“ gerechnet“.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
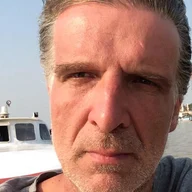







meistkommentiert