Horror-Videospiel „The Lightkeeper“: Blutende Möwen
Zwischen Nebelhorn und Kriegsgeheul entfaltet das Indie-Horrorspiel „The Lightkeeper“ eine eigene Stimme. Gab's das nicht schon einmal als Film?
Nähern wir uns etwas Realem, einem Traum, einer Illusion zwischen Leben und Tod oder doch der Toteninsel von Arnold Böcklin? Der Leuchtturm in der Ferne rückt näher, sein Nebel umhüllt uns und wir setzen die ersten Schritte auf die Insel. Ein Nebelhorn erschüttert die Luft, Möwen kreisen über unserem Kopf und das Geräusch der Brandung empfängt uns.
In dieser anfangs noch idyllischen und überschaubaren Welt kommen wir unserer Arbeit als Leuchtturmwächter nach, wechseln Öl, putzen Lampen, kümmern uns um rudimentäre Elektronik und wärmen unsere Stube mit einem Feuer.
Doch wofür ist die Tür unterhalb des Turms? Was bedeuten die drei Gräber in der Ferne? Warum dringen Kriegsgeräusche an unsere Ohren?
Schon in den ersten Minuten wird klar, wie atmosphärisch „The Lightkeeper“ ist. Das kleine Indie-Horrorspiel entführt uns – wenn auch nur für rund 90 Minuten – in das Jahr 1925 und in die Einsamkeit. Es folgen die üblichen Versatzstücke, die man aus der Vielzahl an kurzen Horrorspielen kennt: Zuerst sind es blutende Möwen, die überall auf der kleinen Insel auftauchen, dann eine Silhouette eines Mannes auf dem Turm und die obligatorische Wanderung mit der Taschenlampe durch die Nacht.
„The Lightkeeper“, ab sofort erhältlich
Die genreüblichen Jumpscares sind erfreulich selten, ist es doch die Soundkulisse, die für Gänsehaut sorgt. Das Spiel braucht lange, um eine eigene Handschrift zu finden. „The Lightkeeper“ ist dem Film „The Lighthouse“ zum Verwechseln ähnlich.
Sechs Jahre zuvor schuf Regisseur Robert Eggers mit seinem Horrorfilm ein Glanzstück, das in den nächsten Jahrzehnten durchaus zum Genreklassiker werden kann. Robert Pattinson und Willem Dafoe spielten sich auf einer verlassenen Insel gegenseitig gegen die runden Wände des Leuchtturms, dekonstruierten Männlichkeitsbilder, Seemannsgarn und griechische Mythen in einem. Zwar zitiert auch das Spiel gleich zu Beginn vollmundig Platon, doch an die Tiefe des Films kann es nicht reichen.
Zudem wirkt es lange so, dass „The Lightkeepeer“ seine Vorlage dreist kopiert und als Inspiration anstatt Epigone ausgibt. Erst nach einigen Gängen über die Insel findet das Spiel seinen eigenen Charakter.
Ebenbild einer posttraumatischen Belastungsstörung
Unsere Spielfigur dringt in den Keller des Leuchtturms vor und deckt die düstere Geschichte der vorherigen Wärter auf. Dabei versinkt die Figur selbst im Alkoholismus, dem sie einst abschwor. Wir lernen seine Vergangenheit kennen, in der er als Weltkriegssoldat durch einen Fehler seine Kameraden verlor. Die Last wiegt schwer auf seinen Schultern und so steht er wieder vor den Kasernenbetten, Gewehren und Giftgasmasken, die er vergessen wollte.
Gerade diese Momente, wenn sich das Spiel von seiner filmischen Vorlage losreißen kann, bleiben in Erinnerung. Die Insel wird zu den Schützengräben des Stellungskrieges, die Erde matschig und übersät mit Leichen, Menschen sterben und verbrennen zu allen Seiten.
„The Lightkeeper“ wird zum Ebenbild einer posttraumatischen Belastungsstörung einer Figur, die durch den Horror auf der Insel aufs Neue gebrochen wird. Damit hat das niederländische Studio Darkphobia Games im See der Horrorspiele eine kleine Perle geschaffen. Die drei möglichen Enden geben dem Spiel einen Wiederspielwert, wenn auch nur einen geringen.
Um noch fesselnder zu sein, hätten die beiden Entwickelnden früher eigene Akzente setzen müssen, anstatt einen Film nachzuerzählen. Zwar zeigen sie rechtzeitig ihre Ideen, doch beschneiden sie sich zuvor nur selbst.
Die Grenze zwischen Inspiration, Aneignung und Nachahmung ist dünn, wird hier oft überschritten und wieder verwischt. Die Originalität lässt sich im Spiel zweifelsfrei erkennen, aber erst, nachdem wir uns mehrere Male vom Leuchtturm haben blenden lassen. Am Ende lohnt sich beides: „The Lightkeeper“ und „The Lighthouse“, am besten in dieser Reihenfolge.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

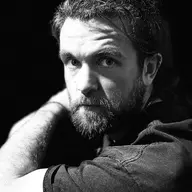




meistkommentiert