Fernwärme kann warten: Kraftwerk in weiter Ferne
Spätestens 2017 sollte das Kohlekraftwerk Wedel durch einen neuen Meiler zur Fernwärmeerzeugung ersetzt werden – dieser Zeitplan ist hinfällig.

Auch wenn es niemand offiziell zugibt: Der Zeitplan ist Makulatur. 2017 sollte, so ist es auf der Vattenfall-Homepage noch immer zu lesen, das in den 60er-Jahren gebaute Kohlekraftwerk Wedel in Rente gehen und durch ein modernes Gas-und Dampf-Kraftwerk (GUD) für die Hamburger Fernwärmeversorgung ersetzt werden.
Die Kraftwerkserneuerung gehört zu dem Paket der für Anfang 2019 geplanten Übernahme des Fernwärmenetzes durch die Stadt und damit zur Umsetzung des Volksentscheids über den Rückkauf der Energienetze. Doch dass das Wedeler Kohlekraftwerk bis dahin vom Netz geht, ist fraglich.
Sicher ist: Frühestens Mitte dieses Jahres wollen Vattenfall und die Stadt Hamburg gemeinsam entscheiden, ob das GUD-Kraftwerk gebaut wird. Vattenfall-Chef Pieter Wasmuth rechnet anschließend mit einer „einjährigen Planungszeit“ bis zum Baubeginn. „Die Bauzeit beträgt erfahrungsgemäß rund drei Jahre“, ergänzt Vattenfall-Sprecherin Karen Hillmer. Im Klartext: Frühestens Mitte 2019 würde das Kraftwerk in Betrieb gehen – ein halbes Jahr nach dem geplanten Rückkauf der Fernwärmenetze durch die Stadt.
Doch auch auf dem Weg dahin liegen weitere Hindernisse. So reichten im Oktober 19 Wedeler KraftwerksanwohnerInnen eine Anfechtungsklage gegen die Genehmigung des GUD-Kraftwerks beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig ein. Die Kläger befürchten vor allem eine akute Lärmbelästigung während der Bauzeit und später durch die Luftkondensatoren, die das Kraftwerk kühlen sollen. Kommt die Klage durch, wäre das Neu-Kraftwerk vom Tisch.
Das Steinkohlekraftwerk Wedel wurde zwischen 1961 und 1965 von den HEW erbaut. Zunächst wurde es ausschließlich zur Stromerzeugung eingesetzt, 1987 dann zum Heizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung umgebaut.
Das geplante Gas- und Dampfturbinenkraftwerk soll vor allem Fernwärme für Hamburgs Westen liefern. Laut Vattenfall soll die Anlage einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 88 Prozent haben.
Ein Wärmespeicher, der ebenfalls am Standort geplant ist, soll so viel Energie in Form von Wärme speichern können, wie ein größerer Windpark innerhalb von zehn Stunden bei optimalen Windverhältnissen an Strom produziert.
Derweil geben sich hinter den Kulissen Vattenfall und die Stadt gegenseitig die Schuld dafür, dass die Neubau-Pläne auf Eis liegen. „Seit dem Volksentscheid im September 2013 ist auf Seiten der Stadt wenig Konkretes passiert“, heißt es in der Vattenfall-Führungsetage hinter vorgehaltener Hand.
Die zuständige Umweltbehörde ließ durch das Aachener Büro BET Alternativen zum GUD-Kraftwerk analysieren. Die Ergebnisse der Studie werden derzeit von Wirtschaft, Politik und Umweltverbänden in Workshops diskutiert; ein erstes „Ergebnisprotokoll“ soll Ende Januar vorliegen.
Dass es „eng“ wird, für den antiken Kohlemeiler noch rechtzeitig eine Alternative an den Start zu bringen, räumt derweil auch die Umweltbehörde ein. Hier heißt es intern, Vattenfall sei nun am Zug, eine klare Investitionsentscheidung zu treffen. So spielen sich der Energieversorger und die staatlichen Planer gegenseitig den schwarzen Peter zu.
Bei Vattenfall trauert man währenddessen noch immer der juristisch und politisch verhinderten Moorburgtrasse nach, über die Hamburgs Westen mit Fernwärme aus dem derzeit in Betrieb gehenden Kohlekraftwerk Moorburg hätte versorgt werden können. Durch die fehlende Fernwärmeproduktion sinkt der Wirkungsgrad des Kohlemeilers von 61 auf 46 Prozent.
„Ohne Fernwärmeabgabe und ohne die Abscheidung und unterirdische Lagerung des entstehenden CO2 ist Moorburg ökologisch nicht vertretbar“, hatte Wasmuths Vorgänger Rainer Schubach einst freimütig erklärt. Beide Optionen haben sich längst erledigt – Moorburg aber geht trotzdem ans Netz.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
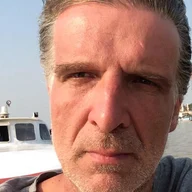




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!