Debatte Antisemitismusbeauftragter: Viel hilft nicht immer viel
Die Bundesregierung will Judenfeindlichkeit stärker bekämpfen. Das kann nur mit einer umfassenderen Antidiskriminierungspolitik gelingen.
D er Diplomat Felix Klein wird Antisemitismusbeauftragter der Regierung. Das neu geschaffene Amt soll zeigen, dass die Regierung auf Judenfeindlichkeit empfindsam und verantwortungsbewusst reagiert. Und es gibt viel zu tun. Die Zahl antisemitischer Delikte, von denen 90 Prozent auf das Konto von Rechtsextremisten gehen, ist unverändert hoch. Neu sind erschreckende Fälle von Alltagsantisemitismus. So wurden in Berlin zwei Schüler von muslimischen Jugendlichen rüde bis zur Handgreiflichkeit gemobbt – weil sie Juden waren.
Die Etablierung eines Antisemitismusbeauftragten klingt da nach einer guten Nachricht. Allerdings hat das Ganze auch etwas von „Viel hilft viel“. Man kann dieses Amt, auch wenn es aus unstrittig lauteren Gründen installiert wird, auch skeptischer sehen. Zum einen fragt sich, ob Klein – ein Mann der Verwaltung, nicht der Zivilgesellschaft – der Richtige dafür ist. In einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen hat er seine Ideen skizziert: Außer auf rechtsextreme und muslimische Judenfeindschaft will er auf „den israelbezogenen Antisemitismus der Linken“ besonderes Augenmerk richten.
Das ist eine Sackgasse. Es gibt seit 50 Jahren hierzulande einen linken Antizionismus, der blind für deutsche Geschichte ist. Er existiert in Nischen, ist immun gegen Selbstaufklärung, moralisch und intellektuell trostlos. Was wir nicht brauchen, ist ein Regierungsbeauftragter für Diskursethik, der Kritik an der israelischen Politik von Amts wegen in legitim und illegitim sortiert. Regierungen als Debattenschiedsrichter sind ein Relikt aus obrigkeitsstaatlichen Zeiten.
Es gibt noch einen Grund für zwiespältige Gefühle. Der Antisemitismusbeauftragte wird im Innenministerium andocken. Der Kampf gegen Antisemitismus ist Regierungssache, während der Islam, so CSU-Innenminister Seehofer, nicht zu Deutschland gehört. Diese Doppelbotschaft verweist auf ein grundlegendes Problem: Ist die Bekämpfung von Antisemitismus etwas Besonderes, Einzigartiges? Oder verstehen wir sie als Teil des Ringens um eine Gesellschaft mit möglichst wenig Diskriminierung? Dies mag spitzfindig klingen. Aber das ist es nicht.
Kann man mit ähnlichem Recht nicht auch einen Antiziganismusbeauftragten fordern? Oder einen gegen Homophobie, Gewalt gegen Flüchtlinge, rassistische Diskriminierung? All das gibt es bereits – in der unscheinbaren Form der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die beim Familienministerium angesiedelt ist. 2006 eher aus Pflicht denn aus Überzeugung installiert, macht sie solide, kleinteilige Arbeit und fristet weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ein Schattendasein. Die Merkel-Union hat sich für Antidiskriminierung nie sonderlich interessiert.
Es ist kein Wunder, dass Deutschland in Sachen Antidiskriminierung schlecht aussieht: Formalrechtlich, so eine EU-Studie, sei in Deutschland Diskriminierung zwar verboten, doch in der Praxis hätten „potenzielle Opfer angesichts schwacher Gleichstellungsgremien und eines geringen staatlichen Engagements“ nicht viel davon. Im EU-Vergleich lag Deutschland, was Antidiskriminierung angeht, 2015 auf Platz 22, hinter Bulgarien, Rumänien und Ungarn. So viel zum „Gendermainstreaming-Wahn“, unter dem die AfD-Klientel so schlimm leidet.
Zudem fällt hierzulande ein Kriterium für Ausgrenzungen glatt durch das Raster: soziale Herkunft. Klassismus, so der sperrige Name, existiert offiziell nicht. Wenn Hartz-IV-Kinder, obwohl begabt, den Aufstieg in Schule und Job nicht schaffen, ist das ihr Problem und keine strukturelle Benachteiligung. Der Soziologe Andreas Kemper hat dazu treffend bemerkt, dass man sich nicht wundern muss, wenn „weiße, heterosexuelle Schüler ohne Migrationshintergrund, die ständig aufgrund ihrer sozialen Herkunft diskriminiert werden“, gereizt reagieren, „wenn sie aufgefordert werden, nicht rassistisch, homophob, sexistisch zu sein.“
Schlägt man also den ganzen Katalog auf, erkennt man, wie problematisch Hierarchisierungen von Opfern sein können. Der Eindruck, dass Juden Diskriminierungsopfer erster Klasse sind, Muslime irgendwie zweiter Rang und wegen sozialer Herkunft Benachteiligte nicht existieren, schadet der Gleichstellung und Chancengleichheit. „Wann wird es selbstverständlich sein, dass jemand mit den gleichen Noten die gleichen Aussichten bei einer Bewerbung hat, egal ob er Yilmaz oder Krause oder anders heißt?“ Das fragte der damalige CDU-Bundespräsident Christian Wulff bei seiner Antrittsrede. Diese Frage ist noch immer so aktuell wie 2010 – nur scheint sie in der Union keinen mehr zu interessieren.
Vorsicht vor „Mobbingranking“
Aber was konkret tun, wenn jüdische SchülerInnen gemobbt werden? Offenbar sind Schulleitungen, wie ein Fall in Berlin zeigt, davon schnell überfordert und neigen dazu, lieber alles unter den Teppich zu kehren, weil sie ein mieses Image fürchten. Unionsfraktionchef Volker Kauder fordert daher eine generelle Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen. Das klingt resolut. Doch wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass dies eher gut gemeint als gut gemacht wäre. Denn damit würde – als unbeabsichtigter Nebeneffekt – eine Art Mobbingranking etabliert: Wenn ein Jude auf dem Schulhof drangsaliert wird, ist das wichtig – wenn Schwule, Behinderte, Muslime, Mädchen gedisst werden, nicht so sehr. Weniger markig, dafür klüger ist der Vorschlag von Familienministerin Franziska Giffey. Statt mit Meldepflicht zu drohen, ermutigt sie Schulleitungen, sich in solchen Fällen nicht wegzuducken. Und verweist auf Antimobbingteams, die helfen können. Egal, welche Religion das Mobbingopfer hat.
Auch der Kampf gegen Antisemitismus wird langfristig nur erfolgreich sein, wenn man ihn als Teil des Streitens für eine Gesellschaft ohne Diskrimierung begreift. Die Berufung des Antisemitismusbeauftragten wäre überzeugender, wenn andere Herabwürdigungen nicht so nonchalant übergangen würden.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






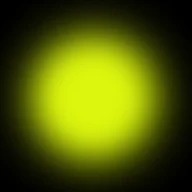
meistkommentiert
Aufrüstung
Wir sind wieder wehrtüchtig – aber wofür eigentlich?
AfD gesichert rechtsextrem
Drei Wörter: AfD, Verbot, jetzt
Blockade der Hilfslieferungen in Gaza
Israel hat jede rote Linie überschritten – und jetzt?
Verfassungsschutz
AfD ist gesichert rechtsextremistisch
Blockade in Gaza
Bittere Hungersnot mit Ansage
Gesichert rechtsextreme Partei
Rufe nach einem AfD-Verbot werden lauter