Carolin Emcke über Homophobie: „Wieso bin ich nicht heterosexuell?“
Eltern sollten sich für ihre Kinder nur wünschen, dass sie glücklich werden, sagt die Journalistin Carolin Emcke. Ein Gespräch über sexuelle Identität und Menschenrechte.

taz: Frau Emcke, der Fußballer Thomas Hitzlsperger hat im Gespräch mit Ihnen und einem Kollegen in der Zeit sein Schwulsein öffentlich gemacht und bekam dafür viele Sympathiebekundungen. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass in Baden-Württemberg eine Unterschriftenliste gegen Sexualaufklärung in Schulen kursiert. Wie erklären Sie sich diese Gleichzeitigkeit von Unverträglichem?
Carolin Emcke: Die Diskussion über die Petition hat es im Netz schon vor unserem Gespräch mit Thomas Hitzlsperger gegeben.
Aber sie drückt offenbar Ängste aus. Was thematisiert diese Petition wirklich?
Gute Frage. Grundsätzlich scheint es um die Angst vor der Instabilität der eigenen Identität zu gehen. Das artikuliert sich seit einer Weile schon gegenüber dem Islam. Also, die Angst, die Sichtbarkeit eines anderen Glaubens könne den eigenen Glauben verunsichern. Und hier artikuliert es sich anscheinend gegenüber Homosexualität. Die Angst, das Sprechen über eine andere Art zu lieben, könne die eigene Sexualität unterwandern. Anscheinend sind Eltern bei ihrem Glauben zuversichtlicher, dass sie den an ihre Kindern weiterreichen können. Bei Sexualität aber spüren sie, dass sie nicht beeinflussen können, wie ihre Kinder begehren werden.
Und was würden Sie solchen Eltern in Baden-Württemberg sagen?
Alles, was ich als Eltern mir wünsche für mein Kind, ist doch, dass es glücklich werden darf, dass ihm nichts zustößt, dass niemand ihm Schaden zufügt. Wenn ich nun ein Kind habe, das fünf oder sieben oder zehn Jahre alt ist, dann kann ich nicht wissen, ob es durch eine Infektion womöglich gehörlos wird oder ob es in der Pubertät entdeckt, dass es schwul oder lesbisch liebt oder ob es vielleicht später keine Arbeit findet. Wenn ich all das als Eltern nicht garantieren kann, wenn ich nicht weiß, was oder wer mein Kind eines Tages sein wird, dann würde ich unbedingt eine Gesellschaft mitgestalten wollen, in der mein Kind respektiert und beschützt ist, ganz gleich, ob es jüdisch, lesbisch, gehörlos oder Bayern-München-Fan ist.
Gleichwohl entzündet sich an Ansprüchen von Nichtheterosexuellen, auch im Schulunterricht nicht exotisiert zu werden, besondere Aggression.
Ja. Ich plädiere allerdings nicht für Gegenaggression. Ich wehre mich, durch die Verachtung, die uns entgegengebracht wird, selbst hasserfüllt zu werden. Es macht einen krank.
Trotzdem fällt auf, dass gerade Schwules und Lesbisches bei vielen Eltern beinahe panische Gefühle auslöst – ganz anders, als der Jubel über Thomas Hitzlsperger Coming-out vermuten lässt.
Man muss mal aussprechen, was da implizit unterstellt wird: das Phantasma, Homosexualität sei ansteckend. Alle, die dafür plädieren, dass Homosexuelle doch bitte nur „im Privaten“ ihre Liebe leben sollen, dass Homosexualität doch bitte nicht sichtbar oder hörbar sein solle und vor allem, dass Kinder keine homosexuelle Eltern haben sollten, sie alle scheinen zu fürchten, dass es ansteckend sein könnte.
46, berichtet u. a. aus dem Kosovo, Afghanistan, Gaza, Irak. Seit 2007 schreibt sie frei, vor allem für die Zeit. Zudem hat sie mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt „Wie wir begehren“ (S. Fischer Verlag).
Homosexuelle als Ansteckende: Damit wird Schwulen und Lesben ja eine ziemlich starke Verführungsqualität unterstellt.
Das Lustige an dieser Logik ist doch: Wenn die bloße Anschauung von Sexualität so wirkungsmächtig wäre – dann frag ich mich, wieso ich nicht heterosexuell geworden bin. Denn das war definitiv die Art des Liebens und Begehrens, die sichtbar und hörbar, in Büchern und Filmen und in allen Konventionen als Norm vorgeführt wurde. Hat als Ansteckung jedenfalls nicht funktioniert.
Die Vorstellung, dass Homosexualität ansteckt, ist ja nicht neu.
Das Motiv, dass „das Andere“ quasi epidemische Qualitäten hat, dass es den „Volkskörper“ bedroht, ist leider wirklich alt. Die Nationalsozialisten haben Juden das Baden in öffentlichen Schwimmbädern verboten. Und mir scheint, auch bei der Aversion gegen das Kopftuch, das muslimische Frauen tragen, kommt oft diese Ansteckungsphobie hoch.
Die Auskunft: In der Zeit vom 9. Januar macht der frühere Bundesliga-Profi Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich.
Der Aufstand: Etwa zur gleichen Zeit berichten Medien über eine Onlinepetition aus Baden-Württemberg. Sie richtet sich gegen den neuen Bildungsplan, der ab 2015 gelten soll. Laut dem Plan würde künftig das Vermitteln von Wissen über „sexuelle Vielfalt“ im Lehrplan verankert. Ein Realschullehrer will das verhindern, knapp 174.000 Menschen haben seine Petition bisher unterschrieben.
Würde mehr Bildung, mehr Aufklärung helfen, solche gräulichen Fantasien zu entkräften?
Gewiss, unter denen, die die Petition unterschrieben haben, sind dogmatisch Religiöse und menschenverachtende Ideologen. Die ändert auch mehr Aufklärung nicht. Aber ich vermute, die breite Mehrheit sind eher ahnungslos wohlmeinende Eltern. Dieser Mitte sollten wir mehr Informationen geben.
… ja, was genau?
Nun, zunächst, dass sie lieben und glauben und trauern und hoffen dürfen, wie sie es möchten. Dass es keine Hierarchie des Begehrens gibt. Und vielleicht sollten sie einmal verstehen: Wir leiden nicht an unserer Homosexualität, sondern an der Homophobie um uns herum. Wir sind glücklich miteinander. Aber es ist leidvoll, das immer wieder gegen Zuschreibungen und Missachtungen erläutern und verteidigen zu müssen. Dadurch wird die eigene Sexualität nämlich viel mehr zu einem Thema, als man das selbst gewünscht hätte. Nicht wir wollen dauernd über Sex reden, sondern es wird uns dauernd nahegelegt – weil wir nur darüber definiert werden.
Nun gibt es aber, womöglich ein Segen für jene, die nun ihr Coming-out durchleben, einen Thomas Hitzlsperger.
Ja. Thomas Hitzlsperger hat wirklich ein schönes Zeichen von Selbstbewusstsein gesetzt. Außerdem bricht mit seinem Coming-out das leidige Klischee von „unmännlichen Homosexuellen“ etwas auf.
Obendrein gibt es wahnsinnig viele heterosexuelle Männer, die schlapp und weich wirken, nicht wahr?
Alles Nonsense natürlich. Das sind eben stereotype Zuschreibungen, die der Vielfalt innerhalb der sozialen Gruppen und Identitäten nicht gerecht werden.
Ihr Buch „Wie wir begehren“ ist eine sehr nachfühlbare Geschichte über Ihr eigenes Coming of Age und das Entdecken ihres Begehrens. Welche Erfahrung haben Sie bei Lesungen gemacht?
Das Schönste an den Reaktionen auf das Buch waren die Leserbriefe. Da haben junge und alte Männer und Frauen geschrieben, übrigens gar nicht nur Homosexuelle. Menschen haben begonnen, die Denkbewegung des Buchs für sich selbst durchzuspielen. Sie haben sich die Frage gestellt, wie sie ihre Schulzeit erlebt haben, in den 40er Jahren, den 50er, den 60er Jahren. Und was sie in der Schule oder in der Gesellschaft ihrer Zeit für Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Intimität, von Scham, von Sexualität vermittelt bekommen haben. Und wie diese Bilder ihr Leben beeinflusst haben.
Haben Sie vom queer acting durch Schwule und Lesben schon profitieren können?
Ja. Ich habe enorm von all denen profitiert, die vor mir meine Rechte erstritten haben. Ich gehöre schon zu einer Generation, die es sich leisten konnte zu sagen, für mich spielt meine Homosexualität keine alles dominierende Rolle. Zumindest, wenn ich in Berlin bin. Trotzdem bleiben immer noch Reste von Ressentiments und Diskriminierung, die es zu kritisieren und zu ändern gilt, es gibt immer noch Milieus, die Homosexualität ablehnen. Die Gleichstellung war doch eines der ersten Themen, die in den Koalitionsverhandlungen untern Tisch gefallen sind.
Es gibt schon Passagen im Koalitionsvertrag.
Niedlich … Die Ehe für alle und das Adoptionsrecht für homosexuelle Eltern sind jedenfalls einkassiert. Da lässt sich die Politik vom Verfassungsgericht treiben.
Weltweit scheint die Situation eher düsterer werdend.
Ja, wir reden zurzeit vornehmlich von Russland. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, in denen Homosexuelle bedroht oder angegriffen werden: Kamerun, Nigeria, Malaysia … die Liste ist trostlos lang.
Sind Sie nicht gelegentlich erschöpft, ewig die gleichen Mühen der Aufklärung zu lancieren, Respekt und grundsätzliche Wertschätzungen zu fordern?
Ja. Manchmal frage ich mich, warum reicht es nicht, einmal die Menschenrechte zu formulieren: „Alle Menschen sind gleich. Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Stattdessen müssen wir dann über Jahrhunderte erklären, wer alles als Mensch zählt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





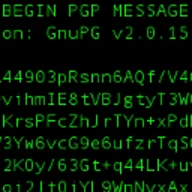

meistkommentiert
Eklat wegen Palästina-Shirt im Bundestag
Schockiert doch mal!
Trotz widersprüchlicher Aussagen
Vermieter mit Eigenbedarfsklage erfolgreich
Bundeswehr an Schulen
Der Druck auf die Jugend wächst
Inhaftierte Antifaschist*in in Ungarn
Maja T. tritt in den Hungerstreik
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer
Im tiefen Tal der Hufeisentheorie
Greta Thunbergs Soli-Aktion mit Gaza
Schräger Segeltörn