Ross-Brüder über ihren neuen Roadmovie: „Als Jugendliche waren wir naiv“
Bill und Turner Ross schicken in „Gasoline Rainbow“ eine Gruppe Jugendlicher auf einen Roadtrip. Wie läuft Reisen ohne Plan und Filmen ohne Drehbuch?

Liebenswürdige Jugendliche: die Protagonisten von „Gasoline Rainbow“ auf dem Weg an die Küste Foto: Mubi Foto: Mubi
Seit über 15 Jahren drehen die Brüder Bill und Turner Ross gemeinsam Filme und haben sich im US-Independent-Kino ihre eigene kleine Nische geschaffen. Eine Art Cinéma verité der amerikanischen Provinz, wahrhaftige und präzise Beobachtungen von Protagonist*innen fernab privilegierter Bürgerlichkeit, ohne feste Drehbücher und mit einem Hang zum Dokumentarischen und Improvisierten. So auch im Fall ihres neuen Films „Gasoline Rainbow“: Fünf Teenager aus einem Kaff in Oregon brechen auf zu einem letzten Abenteuer, bevor die Jugend zu Ende geht.
taz: Bill und Turner Ross, zur Weltpremiere in Venedig sagten Sie, dass es Ihren neuen Film „Gasoline Rainbow“ ohne die Coronapandemie nicht geben würde. Zugleich basiert er auch auf Aufzeichnungen aus Ihrer Jugend, nicht wahr?
Bill Ross IV
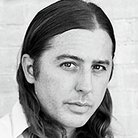
Foto: Mubi
wurde 1980 in Sidney, Ohio, geboren.
Turner Ross: Als Teenager hatten wir im Austausch miteinander allerlei Kurzgeschichten geschrieben, inspiriert von unserem Leben, über das Aufwachsen in einer Kleinstadt in Ohio. Komplett ad acta gelegt haben wir diese Gedanken nie.
Bill Ross: Immerhin war das ein Dokument unserer Jugend, eine Erinnerung ans Jungsein. Aber als dann die Pandemie die Welt zum Stillstand brachte, hatten wir plötzlich sehr viel Zeit, uns unseren Gedanken zu widmen – und wir dachten viel zurück an jene Jahre in der Provinz. Wir blickten aus dem Fenster und sehnten uns in die Ferne. Ein bisschen wie damals, als wir davon träumten, was am Ende der großen Straße liegen könnte, die durch unseren Ort führte. Plötzlich war diese Sehnsucht, von zu Hause auszubrechen und die Welt zu entdecken, wieder ganz präsent. Wir kramten also unsere alten Geschichten hervor und erinnerten uns an unsere damaligen Gefühle. Das war die Basis für „Gasoline Rainbow“.
Ihr Blick auf diese Gefühle und das Jungsein ist doch aber über 20 Jahre später sicherlich ein ganz anderer?
Bill Ross: Oh ja, absolut. Als Jugendliche waren wir unglaublich naiv. Nicht dass wir nicht auch heute noch damit beschäftigt sind, die Welt und uns selbst zu verstehen. Aber damals hatten wir natürlich noch keinerlei Referenzrahmen für das Leben, nur jede Menge Hoffnungen und keinerlei Mangel an Selbstbewusstsein. Das ist doch das Tolle an der Jugend. Gerade durch unsere Geschichten von damals haben wir aber eben auch heute nicht komplett vergessen, wie sich das damals anfühlte. Entsprechend viel Empathie hatten wir nun für die Kids, die wir ins Zentrum unseres Films rückten. Aus Mangel an Erfahrung so ungemein selbstsicher und zuversichtlich zu sein, wirkt auf Erwachsene manchmal irritierend. Aber wir sind alle mal so gewesen, und ich glaube, es braucht nur etwas Geduld und Güte, um sich selbst in diesen jungen Menschen wiederzuerkennen.
Was erklären würde, warum Ihre eigene Mutter über „Gasoline Rainbow“ sagt, es sei Ihr zugänglichster Film …
Turner Ross: Davon waren wir selbst überrascht. Warum kann sie ausgerechnet mit dieser Gruppe Teenager mehr anfangen als mit anderen unserer Filme? Aber ihre Antwort war natürlich einleuchtend: Ich war selbst mal ein Teenager mit ähnlichen Ängsten und Hoffnungen.
War es Ihr erklärtes Ziel, einen Film zu drehen, der universell zugänglich und verständlich ist?
Turner Ross: Zu versuchen, jeden Geschmack zu bedienen, das klingt irgendwie gefährlich. Das kann eigentlich nicht das Anliegen von Kunst sein, oder? Aber wir ermahnen uns schon immer wieder, dass wir in unseren Filmen nicht so speziell werden, dass außer uns selbst da niemand Zugang zu findet. Der Wunsch bei „Gasoline Rainbow“ war schon, dass das Publikum am Ende nicht nur die Erfahrungen dieser Kids wahrnimmt, sondern vielleicht auch über die eigene Jugend nachdenkt. Eine gewisse Durchlässigkeit sollte es geben, damit andere Menschen irgendwo andocken können. Die gelungenste Kunst ist für mich die, deren Rezeption es ermöglicht, individuelle Gedankenräume zu öffnen.
Die Jugendlichen im Film brechen in Oregon ohne wirklichen Plan Richtung Pazifik auf. Auch das eine Erinnerung an früher oder Ausdruck Ihres bis heute anhaltenden Freiheitswunsches?
Turner Ross: Beides, würde ich sagen. Unser eigener Roadtrip in jenem Alter umfasste damals deutlich mehr Straftaten, um es mal so auszudrücken. Die Kids, die wir für unseren Film fanden, waren da anders. Aber wir reisen heute noch gerne so: ohne große Pläne, Vorbereitung oder Ziele. Wir nehmen lieber die wenig befahrenen Umwege als die Hauptstraßen, halten an und sprechen mit den Menschen, denen wir begegnen. Wir trampen auch gerne – und es ist nicht so lange her, dass ich das letzte Mal auf einen fahrenden Zug aufgesprungen bin. Unterwegs zu sein heißt für uns, uns in der Welt zu verlieren und entdecken, wer sie bewohnt. Bei unserem Onkel an der Wand stand der Spruch „Wer zu Hause bleibt, lernt nichts kennen“. Das ist ein gutes Mantra, finde ich.
Sie erwähnten gerade, dass die Teenager, die Sie für „Gasoline Rainbow“ fanden, anders waren als Sie in Ihrer Jugend. In welcher Hinsicht?
Bill Ross: Die größte Überraschung war für uns eigentlich, wie liebenswürdig die alle waren. Und ich glaube, ihre Neugier und Offenheit war deutlich größer als unsere damals in den neunziger Jahren.
Halten Sie das für einen generellen Generationsunterschied oder lag das einfach konkret an diesen Individuen?
Turner Ross: Schwer zu sagen. Mich würde es jedenfalls sehr optimistisch stimmen, wenn unser Ensemble exemplarisch wäre für ihre Altersgenossinnen und -genossen heute. Auf jeden Fall fiel uns das jetzt in der Arbeit mit ihnen schon sehr auf, wie viel weniger oppositionell die Kids drauf zu sein scheinen, im Vergleich zu unserer Generation. Wenn in unserer Jugend jemand anders war als die anderen, dann wurde das thematisiert, er wurde ausgegrenzt oder mindestens komisch angeguckt. Heute scheinen die Reaktionen eher zwischen Achselzucken und „oh, cool, du bist anders“ zu liegen. Ich finde das großartig.
Auch mit den Teenagern haben Sie wieder ohne festgelegte Dialoge und echtes Drehbuch gearbeitet, sondern sie vor allem machen lassen und einfach mit der Kamera begleitet. Trotzdem mussten Sie ja irgendwie die Zügel in der Hand behalten. Wie genau lief dieser Arbeitsprozess ab?
Bill Ross: Natürlich haben wir bestimmte Vorstellungen und Ideen, aber die Kids haben auch sehr viel Freiheit, ihr eigenes Ding zu machen. Wir trafen uns jeden Morgen und sprachen darüber, von welcher Ausgangslage aus wir in den Tag starten und welche Themen man vielleicht besprechen könnte. So als grobe Richtlinie, weil wir zumindest einen Leitfaden für die Geschichte des Films hatten. Aber wenn die Kameras einmal liefen, dann war es das. Es gab kein Dialog-Drehbuch und es rief auch nie irgendwer „cut“.
Turner Ross

Foto: Mubi
wurde 1982 in Sidney, Ohio, geboren. Er und sein Bruder Bill arbeiten als Regisseure unter dem Namen The Ross Brothers. Ihr Spielfilm „Bloody Nose, Empty Pockets“ lief 2020 beim Sundance Film Festival und anschließend auf der Berlinale. „Gasoline Rainbow“ feierte seine Premiere 2023 in Venedig
Turner Ross: Am Ende sieht „Gasoline Rainbow“ nun durchaus so aus, wie wir uns das ausgemalt hatten. Aber keine der wunderbaren Situationen und Begegnungen, aus denen der Film besteht, standen in unserem Entwurf, mit dem wir das Projekt begonnen hatten. Denn die Geschichte wird von denen erzählt, die darin vorkommen. Nichts war geplant, aber alles passierte innerhalb des Rahmens, den wir uns vorgestellt hatten. Unsere Aufgabe war es einfach, die Bedingungen und den Raum dafür zu schaffen, dass dieses Ergebnis dabei herauskommen kann.
Selbst die Begegnungen mit anderen Menschen waren nicht geplant?
Bill Ross: Einige entstanden tatsächlich rein zufällig. Andere waren insoweit geplant, dass wir gezielt Menschen – wohlgemerkt keine Schauspieler – „gecastet“ haben, die mit unseren Kids interagieren sollten.
Turner Ross: Aber es gab ja nie ein Filmset im eigentlichen Sinne und wir wussten nie, wie diese Aufeinandertreffen tatsächlich ablaufen würden. Davon, dass wir für den sechswöchigen Dreh natürlich einen gewissen Zeitplan im Kopf hatten und wussten, dass wir grob drei Drehtage für einen Tag im Film hatten, bekamen die Kids nichts mit.



