Koch über sein Private-Kitchen-Konzept: „Alte Kartoffeln sind spektakulär“
Nur zwölf Gäste können an einem Abend im „Ernst“ essen, aber sie kriegen bis zu dreißig Gänge. Der Koch Dylan Watson-Brawn über seine Restaurant-Philosophie.

taz.am wochenende: Herr Watson-Brawn, Sie eröffnen eine Private Kitchen, in der die Gäste quasi in der Küche sitzen. Wie muss man sich das vorstellen?
Dylan Watson-Brawn: Bei uns, im Ernst, werden Sie an einer Bar sitzen, dahinter steht ein kleines Team von vier Leuten. Pro Abend bekochen wir bis zu zwölf Gäste. Es gibt keine Speisekarte, das Menü besteht aus 20 bis 30 Gängen, je nach Saison.
Was ist für Sie als Koch an diesem Setting mit wenigen Gästen so interessant?
Die Kontrolle. Wenn man für so wenige Gäste kocht, ist es möglich, sich um vieles mehr Gedanken zu machen als in einem großen Restaurant und sich dann auch selbst darum zu kümmern.
Bei 30 Gängen ist aber trotzdem viel zu tun.
Denken Sie jetzt nicht an Gänge wie im Sterne-Restaurant! Dort liegen meist fünf bis zehn Komponenten auf dem Teller. Das werden sie bei uns nicht bekommen. Ein bis zwei Komponenten, mehr nicht.
Sehr puristisch.
Es kommt uns sehr auf die Frische an, die Reife der Zutaten, auf das, was gerade Saison hat. Es geht uns nicht darum, als Köche unsere Muskeln zu zeigen, sondern um die Stärke und Qualität der Produkte. Das ist mir viel wichtiger als eine komplizierte Zubereitung.
Nehmen wir eine Tomate.
Gutes Beispiel. Wir werden sie nicht einfrieren und zerklopfen, wir werden kein Gelee davon machen oder sie für irgendeinen Zweck in Klarsichtfolie packen. Aber wir werden sicherstellen, dass sie zum idealen Zeitpunkt gepflückt wurde, dass sie auf dem Weg vom Feld in die Küche nie im Kühlschrank war und dass sie die richtige Temperatur hat, wenn sie auf den Teller kommt. Wir werden sie erst im letzten Moment schälen und dann so schneiden, das sie das beste Aroma hat, vielleicht mit etwas Salz dazu.
Sie haben lange in Japan gearbeitet. Auch in Sushi-Bars stehen die Köche den Gästen direkt gegenüber, und es gibt viele kleine Gerichte.
Diese Philosophie hat mir imponiert. Die konzentrierte Suche nach Qualität bei den Zutaten. Bis wir eine ähnliche Sensitivität entwickelt haben, ist es noch ein langer Weg. Es wird bei uns übrigens auch Fisch geben, aber viel mehr Gemüse.
Was verändert sich, wenn man so viele Teller vorgesetzt bekommt?
Es geht weniger um das einzelne Gericht. Viele Gäste möchten sich zwar gern an ein oder zwei besonders gute Gerichte erinnern. Es gibt Köche, die ihren Menüs eine Dramaturgie geben, um einzelne Gänge ins Licht zu setzen. Das wollen wir nicht. Das Essen bei uns soll ein Prozess sein, das mit der Reservierung anfängt und erst aufhört, wenn der Gast uns verlässt.
Schon bei der Reservierung?
Wir werden nicht mit normalen Reservierungen arbeiten, sondern mit einem Ticketsystem.
Ich muss Wochen vorher ein Ticket kaufen, so wie für ein Konzert?
Ja. Bei einer so kleinen Zahl von Plätzen können wir uns keine Gäste leisten, die sich am Nachmittag überlegen, dass sie abends etwas anderes vorhaben. Und wenn wir nicht ständig ein Ohr am Telefon haben, bleibt mehr Zeit, sich ums Essen zu kümmern.
Was ist der Unterschied, wenn man so nah am Gast ist?
Es ist ein ganz großer. Wir möchten nicht nur Interaktion mit unseren Gästen. Das Setting erlaubt es, dass das ganze Team an einem Gericht arbeitet.
23, wurde in Vancouver geboren und brach früh die Schule ab, um zu kochen. Nach einer Ausbildung in Tokio ging er nach Kopenhagen und New York. Das Berliner Restaurant "Ernst" steht kurz vor der Eröffnung.
Normalerweise funktioniert eine Restaurantküche anders.
Ja, man muss ständig vom Hauptgang zum Dessert und wieder zu einer Vorspeise switchen. Die Küche ist arbeitsteilig. Normalerweise steht der Chefkoch am Pass, am Ausgang der Küche. Er kontrolliert und richtet an. Ich habe mit diesem Konzept Probleme.
Warum?
Wenn der Chefkoch derjenige ist, der am besten kochen kann, sollte er genau das tun. Und so ist unser Restaurant organisiert: Es soll Zeit bleiben, sich um Zutaten zu kümmern, Produzenten zu besuchen und zu kochen. Die Administration haben wir so weit wie möglich minimiert.
Was sagt es über unsere Esskultur aus, wie wir Köche behandeln?
In Japan werden Köche mit mehr Respekt behandelt, in Europa ist das anders. Es gibt zwei Extreme: die wenigen prominenten, um die ein Kult gemacht wird, daneben die namenlose Masse an Köchen, jederzeit austauschbar. Ich verstehe nicht, warum es nichts dazwischen geben kann. Menschen, die für ihr Handwerk mit Respekt behandelt werden. Wenn Köche Rockstars sind, geht es doch nicht mehr ums Kochen.
Sie legen so viel Wert auf die Qualität und die Auswahl der Produkte. Mir drängt sich das Bild vom Koch als Kurator auf.
Ein schöner Vergleich. Der Kurator wählt ja nicht nur aus, er arbeitet mit den Künstlern zusammen. So wollen wir das auch machen. Mit den Produzenten sprechen, ihre Erfahrungen hören, Anregungen geben.
Gehen wir mit dem Vergleich noch weiter. Geht es darum, dass die Produkte ins beste Licht gesetzt werden?
Definitiv. Nur ganz selten werden wir die Qualität noch verbessern können, denn eigentlich ist das unmöglich. Man kann kein exzellentes Gericht machen, wenn man keine exzellenten Zutaten hat. Und Exzellenz hat nichts damit zu tun, ob man Kaviar, Hummer oder Kartoffeln einsetzt. Es geht nur um den richtigen Moment.
Und was ist der richtige Moment für Kartoffeln?
Frische Kartoffeln sind gut, aber noch besser sind Kartoffeln, wenn sie einige Monate gelagert werden, bis Januar oder Februar. Sie dehydrieren etwas, der Geschmack intensiviert sich und auch die Farbe. Das Gelb ist viel tiefer. Das ist spektakulär.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





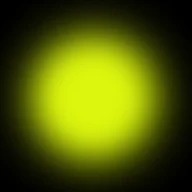

meistkommentiert
Vorgezogene Bundestagswahl
Ist Scholz noch der richtige Kandidat?
113 Erstunterzeichnende
Abgeordnete reichen AfD-Verbotsantrag im Bundestag ein
USA
Effizienter sparen mit Elon Musk
Bürgergeld-Empfänger:innen erzählen
„Die Selbstzweifel sind gewachsen“
Ein-Euro-Jobs als Druckmittel
Die Zwangsarbeit kehrt zurück
Aus dem Leben eines Flaschensammlers
„Sie nehmen mich wahr als Müll“