Demografischer Wandel in Brandenburg: Das Leben der Totgesagten
Während Berlin wächst, schrumpfen im Umland die Ortschaften. Wie die brandenburgische Gemeinde Schipkau ihren Weg sucht.

Man könnte sagen, die Gemeinde Schipkau in der brandenburgischen Lausitz ist ein Produkt des Verfalls. Sechs Dörfer, die nach der Wende mit dem Wirtschaftseinbruch und dem Wegzug der Einheimischen zu kämpfen hatten. Ende 2001 haben sie sich zu einer Gemeinde zusammengeschlossen, um die einzelnen Dörfer vor dem Verschwinden zu bewahren.
Die Herausforderungen sind gigantisch: Der dominante Braunkohletagebau hat nach der Wende schließen müssen. Und auch wenn die Bagger die Gemeinde verschont haben, sind weitere Unternehmen und damit die Menschen verschwunden. Von 8.350 Einwohnern bei der Gemeindefusion sind heute noch rund 6.800 verblieben. Was also hält einen Ort am Leben, der so ums Überleben kämpft wie Schipkau?
Verkauf für eine D-Mark
Es braucht Einzelpersonen, es braucht ihre Ideen, ihr Engagement, um den Verfall des Dorfs zu verhindern. Horst Pawlik ist einer von ihnen. Er ist geblieben, als viele gingen. Pawlik, 70 Jahre alt, hat dünnes Haar, eine laute Stimme und einen leicht wankenden Gang. Er erzählt leidenschaftlich gern. Er ist hier geboren, hat wie die meisten im Glaswerk gearbeitet und ist seit über zwanzig Jahren Ortsvorsteher in Annahütte.
Sein Amtsantritt fiel in eine besonders harte Zeit für den Ortsteil. Nach der Wende wurde das Glaswerk mit rund 400 Beschäftigten mitsamt der Arbeitersiedlung vom Liegenschaftsfonds an einen Investor aus dem Westen verkauft – für eine D-Mark. Der betrieb das Werk zunächst weiter, strich Subventionen in Millionenhöhe ein, schloss nach wenigen Jahren die Hütte wieder, verkaufte die Reste des Werks für siebenstellige Beträge nach Cottbus und die Häuser der Siedlung für 400.000 DM zurück an das Land Brandenburg. „Wirtschaftskriminalität haben wir hier direkt vor der Haustür“, sagt Pawlik dazu. Dabei ist das eigentlich Tragische, dass alles legal war.
Pawlik und seine Freunde wollten nicht zusehen, wie der Ort langsam ausstarb. Ein frisch gegründeter Verein machte sich daran, das zerfallende Gotteshaus zu renovieren „Wir wollten die Kirche im Dorf lassen“, sagt Pawlik lachend. Heute ist die Henriettenkirche die Sehenswürdigkeit des Orts, und regelmäßig finden dort Veranstaltungen statt, darunter die Brandenburgischen Sommerkonzerte.
Trotzdem fehlt es an Arbeit in Annahütte. Von einst 60 Gewerbetreibenden sind nur noch 21 aktiv. Der größte Arbeitgeber ist jetzt das Altenheim mit über 100 Arbeitsplätzen. Dessen Ansiedlung 2006 war ein großer Erfolg.
Künstler in die Glaswerksiedlung?
Das Sorgenkind bleibt die Glaswerksiedlung. Sie steht unter Denkmalschutz, das macht die Sanierung kostspielig. Heute stehen 70 Prozent der Häuser leer, immerhin 30 Prozent sind liebevoll renoviert. Sie wirken etwas verloren zwischen den anderen Backsteinhäusern mit bröckeligem Mauerwerk und zugenagelten Fenstern. Es muss ein komisches Gefühl sein, von Häusern umgeben zu sein, aber nicht von Nachbarn.
Dabei haben sie im Ort alles versucht, um neue Nachbarn zu finden. Bei der Sanierung der Siedlung sollten zunächst Subventionen vom Land helfen – mit der Auflage, die Häuser bis 2015 zu privatisieren. Da sich keine Käufer fanden, musste die Gemeinde im großen Stil Subventionsmittel zurücküberweisen. Fortan standen die Häuser für einen Euro zum Verkauf. „Wir dachten, die rennen uns die Bude ein“, erzählt Pawlik. Aber kaum jemand zeigte Interesse. „Mehr Menschen wie Herrn Kersten bräuchten wir hier.“
Antonius Kersten ist eine der schillerndsten Figuren im Dorf – und Zugezogener. Der Holländer trägt eine Lederjacke, die Haare zur Seite geschwungen und eine dieser modernen Brillen mit breiten Bügeln. Er besitzt auch eine Wohnung im Herzen Amsterdams, seine Zeit verbringt er aber lieber in Schipkau. „Hier ist es einfach besser“, sagt er. „Zumindest, wenn man es sich leisten kann, nicht ortsgebunden zu arbeiten.“
Prinzip: selber machen
So wie er, der Filmemacher, der 2004 auf der Suche nach einem Grundstück nach Schipkau kam. Was er fand, war das Haus des ehemaligen Glashüttendirektors. „Welcher Wahnsinn reitet den Mann, diese Bude zu übernehmen“, dachte Pawlik damals. Das Haus war heruntergekommen, aber Kersten und seine Frau waren gewillt, etwas daraus zu machen. Heute kennt jeder das herrschaftliches Haus wenige Meter von der Kirche entfernt. Aufwendiger Stuck ziert die Decke, und antik möblierte Zimmer sowie alte holländische Gemälde sorgen für Charme.
Villa Heyde, hat Kersten sein Haus genannt, zu Ehren des ehemaligen Glashüttendirektors, und gelegentlich scheint es so, als sei Kersten auf dem besten Weg, eine ähnlich wichtige Rolle für den Ortsteil einzunehmen. Neben seinen Filmprojekten über das Dorf oder seinem Engagement in Film-AGs an Schulen, finden in seinem Haus Veranstaltungen statt.
Selbermachen ist zu Kerstens Prinzip geworden. Der agile 64-Jährige hat große Ideen für die verfallende Glaswerksiedlung: „Wir brauchen Kreativität. Die Siedlung wäre super für Künstler.“ Doch Banken gewähren häufig keine Kredite, da sie auf die Gewinnchancen in dieser Region kaum vertrauen. Ortsvorsteher Pawlik stützt sich auf die Ellenbogen, beugt sich nach vorn und sagt mit seiner kräftigen Stimme: „Unter diesen Umständen musst du kämpfen.“
Gekämpft haben sie um ihren Kindergarten. Den wollte die Gemeinde schließen, als er sich 1998 nur noch um 19 Kinder kümmerte. Heute sind es über 100. Wie in der Kirche haben die verbliebenen Annahütter angepackt und den Kindergarten schön gemacht. Auch die Grundschule hat in diesen Tagen ihre Existenzzusicherung für weitere drei bis fünf Jahre erhalten. Es sind die kleinen Erfolge, die zählen.
Gemeinschaftsgefühl ist wichtig
Was ein Dorf zum Überleben braucht, sind die Vereine. Wichtiger als Einkaufsmöglichkeiten. Macht der Dorfladen dicht, läuft das heute eben größtenteils über Bestellungen per Internet. Aber die Gemeinschaft, die die freiwillige Feuerwehr, Heimat- und Fußballverein oder Chor erzeugen, ist kaum zu ersetzen.
Der Großstädter Kersten schwärmt davon: „In Amsterdam trifft man in einer Stunde mehr Menschen als hier an drei Tagen. Dafür redet man hier in einer Stunde mehr miteinander als in Amsterdam an drei Tagen.“
Solche Worte sind Balsam auf die Seele des Schipkauer Bürgermeisters Klaus Prietzel (CDU), eines großen, schlanken Mannes mit festem Händedruck, tiefer Stimme und gut sitzendem Anzug. Sein Ziel ist es, die Wende für Schipkau zu schaffen: von der Schrumpfung zum Wachstum.
Die Entstehung von Solarenergieanlagen und ein Bürgerstrommodell, das für jeden Bürger von den üppigen Einnahmen der Betreiber immerhin 80 Euro jährlich ausschüttet, die neue Ladenzeile im gleichnamigen Ortsteil Schipkau und die Sanierung der Kitas sind für den Bürgermeister genauso Vorzeigeprojekte wie der Windpark Klettwitz. Trotzdem gilt in Schipkau: Die fossilen Energien gingen, die erneuerbaren kamen, unterm Strich fehlen Arbeitsplätze.
Unkonventionelle Methoden sind erlaubt
Um das zu ändern, helfe nur eine schlanke Verwaltung und eine niedrige Gewerbesteuer – meint Prietzel, der so unternehmensfreundlich wie möglich agieren will. Wenn private Leute Ideen für den Ort haben, aber die Banken keine Kredite geben, dann springt schon mal die Gemeinde als Kreditnehmer ein. Unkonventionelle Methoden sind gefragt, wenn es mit Schipkau eines Tages wieder bergauf gehen soll.
Trotzdem sind es kleine Schritte in einem langen Prozess, große Träume gehören der Vergangenheit an: „Wir müssen uns von der Idee von Ansiedlungen mit Tausenden Arbeitsplätzen verabschieden“, sagt Prietzel. „Bayerische Verhältnisse stehen hier eben nicht in Aussicht.“ Er glaubt an die Kraft der kleinen Unternehmen, mehr als an Großprojekte wie dem Lausitzring.
Als wirtschaftlichen Rettungsanker investierte das Land Brandenburg kräftig in den Bau der Rennstrecke. Die Formel 1 sollte kommen und kam nie, genauso wenig wie die versprochenen 1.000 Arbeitsplätze.
Besonders mitarbeiterfreundlich
Eines von Prietzels Lieblingsbeispielen ist die Firma Haltec im Ortsteil Meuro. Der Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins Frank Noack leitet dort seit 2001 ein technisches Büro. Noacks Bereich wächst. Mittlerweile beschäftigt er 19 Mitarbeiter, die Pläne für Hallen und Zeltkonstruktionen entwerfen und statistische Berechnungen liefern. „Wenn du generell an einem unattraktiven Ort bist, musst du dich als Arbeitgeber anstrengen und besonders mitarbeiterfreundlich sein“, sagt er .
Im Bürgermeisteramt kommen derweil jeden Montag die Einwohnerzahlen auf den Tisch – als Messzahl für die Entwicklung des Orts. „Davon hängt dann ab, ob ich in der Woche gute oder schlechte Laune habe“, sagt Prietzel und holt zu seinem größten Trumpf aus: eine Statistik des Jahres 2016, der zufolge die Einwohnerzahl der lange geschrumpften Gemeinde um acht Einwohner gestiegen ist.
Zwar spielen auch die schwankenden Zahlen von aufgenommenen Geflüchteten eine Rolle, doch trotzdem scheint es, als wäre zumindest der Abwärtstrend in Schipkau vorerst gestoppt. Vielleicht wächst es ja eines Tages wieder, wenn die Städte so teuer geworden sind, dass das Land wieder beliebt wird. Davon reden sie hier gern. Zukunftsmusik.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
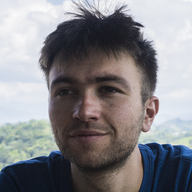




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!