Rassistische Narrative aus Europa: Kants ganz anderer Kontinent
Wenn es um Afrika geht, beruft sich Schengen-Europa auf alte rassistische Erzählungen und Wörter. Eine gerechtere Sprache ist möglich.

„Die Zukunft ist bereits da, sie wurde nur nicht gerecht verteilt.“ Die mahnenden Worte des Internetvisionärs William Gibson widersetzen sich der kapitalistischen Logik eines „Warum sollte ich teilen, wenn ich nicht muss?“ Das betrifft auch Europas Politik, AfrikanerInnen auszusperren. Bundespräsident Gauck mahnte daher am vergangenen Wochenende in Malta: „Wer viel hat, muss viel teilen.“
Einst tränkte Europa den Atlantik mit dem Blut von Millionen versklavter Menschen. Millionen vereitelte Zukünfte. Aus europäischer Sicht nicht zum Überleben bestimmt, trotzten afrikanische Menschen und von ihnen errichtete Diasporas diesem Leid widerständig neue Zukünfte ab. Diese haben Afrika ebenso wie Amerika und Europa nachhaltig verändert. Letztere können nicht mehr als „weiße“ Kontinente begriffen werden.
Das „weiße“ christliche Europa ist nichts als ein konservativer Mythos. Aber mächtig. Sich auf Herkünfte berufend, verschließt er Europa. Im Ergebnis wird das Mittelmeer, wie einst der Atlantik, zum Massengrab afrikanischer Menschen. Einst wie heute, im kolonialen wie im Schengen-Europa, sucht(e) Europas Unrecht Zuflucht in rassistischen Erzählungen und Wörtern.
Humanistische, christliche und aufklärerische Binarismen wie Tier und Mensch, Schwarz und Weiß, Natur versus Kultur, Emotion versus Verstand, Entwicklung versus Stagnation waren willkommene Vorlagen für rassistische Theorien um „Hautfarbe“, Schädel und Blut. „Weiße“ Intellektuelle wie Daniel Defoe, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Hegel und Eugen Fischer erfanden ihr Afrika, das vor allem eines sein musste: „ganz anders“. Europa stand in dieser Logik für Kultur und Zukunft – in Antithese zu Afrika als Natur im „Warteraum der Geschichte“, wie der indische Historiker Dipesh Chakrarbarty es nennt.
„Warteraum der Geschichte“
Koloniale Erfindungen Afrikas sind längst nicht Geschichte. Und Sprache spielt dabei von jeher eine zentrale Rolle. Im Sprechen über Afrika (als anderes) weigerte sich Europa, sowohl bereits bestehende lokale Begriffe zu übernehmen als auch eigene Begriffe analog anzuwenden. Neue Wörter wurden geschaffen, alte umgedeutet und auf diverse gesellschaftliche Kontexte des afrikanischen Kontinents verallgemeinernd angewendet.
Da diese Fremdbezeichnungen von der Idee „menschlicher Rassen“ getragen sind, ist auch jedes Zitieren eine Giftdosis. Deswegen spreche ich in Vorträgen und wissenschaftlichen Artikeln die Wörter nicht aus. Doch in diesem Zeitungsartikel gibt es nach Diskussionen mit der taz-Redaktion nur die Möglichkeit, die nächsten Absätze nicht zu lesen. In ihnen bespreche ich zehn rassistische Begriffe.
ist Professorin für Englische Literaturwissenschaft an der Universität Bayreuth. Sie arbeitet mit Kritischen Theorien der Postcolonial, Gender und Posthumanism Studies. Vor Kurzem erschien die zweite Auflage ihres Buchs „Die 101 wichtigsten Fragen. Rassismus“ beim C. H. Beck Verlag in München.
Ein Beispiel für eine Begriffsübertragung von einem historischen Kontext auf das je zeitgenössische Afrika ist „Stamm“. Es folgt einer evolutionistischen Konzeptualisierung von gesellschaftlicher Entwicklung und unterstellt „Primitivität“ und damit das Fehlen „zivilisatorischer“ politischer Strukturen. Zu den Bedeutungserweiterungen von Begriffen aus dem Tier- und Pflanzenreich zählt das Schimpfwort: „Bastard“. In Flora und Fauna benennt es die Nachfahren verschiedener Spezies, die selbst nicht fortpflanzungsfähig sind.
Diskriminierende Einverleibung
Wird er auf Menschen übertragen, so steht dahinter die Logik, Menschlichkeit – ja – die Legitimität abzusprechen, am Leben zu sein und dieses weiterzugeben. Umso erschreckender, dass dieser Begriff bis heute (ebenso wie „Mulatte“, der in Anlehnung an mulo/Maulesel derselben Logik folgt) zur Bezeichnung von People of Colour mit einem weißen Elternteil herangezogen wird.
Zu den Neologismen gehören Bezeichnungen, die der rassistischen Logik von „Hautfarben“ verpflichtet sind. Dazu gehört das „N-Wort“ ebenso wie „Farbige“ und „Schwarzafrika“. „Häuptling“, „Hottentotten“ und „Buschmänner“ wiederum sind Neologismen, die bestehende politische Strukturen in Afrika verallgemeinern und diskriminieren. Das Suffix -ling hat immer eine diskriminierende Wirkung (wie in Emporkömmling) oder drückt hierarchische Unterlegenheit aus wie in Schmetterling, der eben eines nicht tut: schmettern.
Diskriminierende Einverleibung
Ein „Häuptling“ ist also eines nicht: ein echtes Haupt, ein „wahrer“ Politiker. „Hottentotten“ bezeichnet alle Gesellschaften, in deren Sprachen sogenannte Klicklaute vorkommen. Diese Sprachen wurden in europäischen Ohren mit Hufgeräuschen von Pferden verglichen. „Busch“ wiederum suggeriert wie etwa auch „Dschungel“ einen Naturraum, der sich menschlicher Ordnung entzieht (es sei denn, Mann heißt Tarzan oder Robinson Crusoe).
Als „Buschmänner“ galten konkret jene Gesellschaften des südlichen Afrikas, die nicht in den Küstenregionen lebten, sondern in Gegenden, die für Weiße zunächst schwer zu kolonisieren waren.
Die diskriminierende Einverleibung afrikanischer Menschen schließt dabei ein, dass alle Menschen als „Männer“ galten: So wenig sinnvoll das Zweigendern von Menschen auch sein mag, alle Menschen als Männer zu bezeichnen, folgt der humanistischen Logik, nur überlegene Lebewesen nach Geschlecht zu differenzieren. Im Duden erlangt diese Absurdität eine Klimax, wenn es hier zur Wiederfindung des zweigendernden Musters heißt: „Buschmannfrau“.
Widerständige Selbstbezeichnungen
Will man sich dem Rassismus sprachlich entgegenstellen, so stehen Eigenbezeichnungen zur Verfügung. Dazu zählt etwa Schwarze oder People of Color. Beides sind widerständige Selbstbezeichnungen, die aus antirassistischen Bürgerrechtsbewegungen heraus umfunktioniert wurden. Sie meistern die schwierige Gratwanderung, genau zu benennen, wo der Rassismus einen Menschen positioniert, und zugleich dieser rassistischen Verortung zu widersprechen.
Allerdings haben es diese Wörter in der Bundesrepublik Deutschland bislang sehr schwer. Zugleich herrscht aber unter vielen „weißen“ Deutschen große Empörung über die Verbannung rassistischer Begriffe. 2013 etwa hat der Literaturkritiker Denis Scheck in der ARD Sendezeit dafür erhalten, in der rassistischen Montur der Minstrel Shows verkleidet – von Blackfacing, über rote Lippen und weiße Handschuhe –, für die Verwendung des „N-Worts“ in Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ zu streiten.
Mal abgesehen von dem kleinen Detail, dass Lindgren gar nicht in Deutsch schrieb und Übersetzungen allgemein davon leben, zeitgemäß zu sprechen: Was bewegt privilegiert lebende „weiße“ Erwachsene wie Denis Scheck dazu, für ein garstiges Wort (in einem Kinderbuch) zu streiten?
Sprache, die gerechter ist
Die Antwort liegt in einer Gegenfrage: Was passiert, wenn sich Wörter wie das „N-Wort“ nicht mehr als „nicht rassistisch gemeint“ hofieren lassen? Ein schaler Beigeschmack wird sich auf Jahrzehnte „weißer“ deutscher Medienarbeit legen. Diese wird schon seit Langem von Initiativen von People of Color in Deutschland herausgefordert, etwa Noah Sows „Der braune Mob e. V.“ oder die Neuen Deutschen Medienmacher, die journalistischem und alltäglichem Sprechen neue Horizonte eröffnen.
Der Verzicht auf kolonialistisch geprägtes Vokabular wird die Geschichte nicht ungeschehen machen. Jedoch eröffnet er die Möglichkeit einer Sprache, die gerechter ist. Und nicht zuletzt bereitet dieser Verzicht neuen lokalen und globalen Zukünften den Weg mit dem Mittelmeer als Brücke, nicht als Bollwerk zwischen Europa und seinem Nachbarkontinent Afrika.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







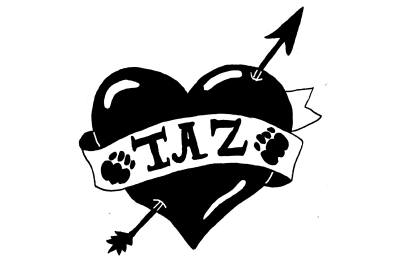
meistkommentiert
Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek
„Ich freue mich darauf, zu nerven“
Immer mehr Kirchenaustritte
Die Schäfchen laufen ihnen in Scharen davon
Regierungsbildung
Die kleine Groko hat einen Vertrauensvorschuss verdient
Flüge mit Privatjets im Jahr 2024
Emissionen durch Bonzenflieger auf Rekordniveau
Zukunft des ÖPNV
Deutschlandticket trägt sich finanziell selbst
Riot Dogs in der Türkei
Wenn selbst Hunde für den Widerstand bellen