Politische Korrektheit: Ich, Zigeuner
Wer „Sinti und Roma“ sagt, glaubt, es richtig zu machen. Man kann aber auch „Zigeuner“ sagen. Solange man nicht ein fahrendes Volk mit dunklen Augen meint.

Stellen Sie sich vor, sie bestellen ein „Romaschnitzel“ oder „Ethnoschnitzel“ statt eines „Zigeunerschnitzels“. Klingt komisch, ist es aber nicht. So steht es in ungarischen Speisekarten. Die Ordnung politisch korrekter Begriffe hat ihre Fallstricke, und die Leute werden immer unsicherer, wie sie Angehörige dieser Ethnie nennen sollen. Ist es wirklich ein Zeichen von Aufklärung, die Begriffe Sinti und Roma zu verwenden? Nur weil „Zigeuner“ als eindeutiges Schimpfwort gilt?
Für mich ist die Antwort eindeutig: Ich bin Zigeuner. Und ich bin nicht damit einverstanden, dass der Begriff „Zigeuner“ ein mit Klischees und Vorurteilen belastetes Schimpf- und Schmähwort ist. Und gleichzeitig finde ich es schwierig, dass einige meiner Bekannten mich nicht „Zigeuner“ nennen. Mit dem Gebrauch politisch korrekter Begriffe stellt sich nicht unmittelbar Respekt ein. Und die alltägliche Diskriminierung wird nicht dadurch geringer, dass man die Bezeichnungen „Sinti“ und „Roma“ benutzt.
Das ungarische „Cigány“ (Zigeuner) ist nur ein Wort. Es sagt nichts über das Verhältnis zu Vertretern dieser Volksgruppe aus. Ein Großteil der Ungarn weiß sowieso kaum etwas über mein Volk und hat wenig persönliche Erfahrungen mit uns. „Du hast blaue Augen, du bist kein Zigeuner!“, sagte zum Beispiel ein Mädchen in Deutschland zu mir, und sie war sehr erstaunt, dass ich darauf beharrte, einer zu sein. Dabei hatte sie sich auch noch geirrt: Die Farbe meiner Augen ist grün.
Diese Episode ist wieder einmal ein Beweis dafür, dass die Leute es nur schwer akzeptieren können, wenn jemand nicht ihren Vorurteilen und Klischees entspricht. Viele können nicht glauben, dass Zigeuner Schriftsteller, Ärzte, Ingenieure oder Journalisten sind – so wie ich. Arbeitslosigkeit, Armut, Ausgrenzung – Zigeuner haben weitaus massivere Probleme als die Bezeichnung ihrer Zugehörigkeit.
„Weil ich ein Zigeuner bin“
Gedöns ist Umwelt, ist, was wir essen, wie wir reden, uns kleiden. Wie wir wohnen, lernen, lieben, arbeiten. Kinder sind Gedöns, Homos, Ausländer, Alte. Tiere sowieso. Alles also jenseits der „harten Themen“. Die taz macht drei Wochen Gedöns, jeden Tag vier Seiten. Am Kiosk, eKiosk oder direkt im Probe-Abo. Und der Höhepunkt folgt dann am 25. April: der große Gedöns-Kongress in Berlin, das taz.lab 2015.
Wenn jemand mich fragt: „Du arbeitest, du hast studiert, warum nennst du dich Zigeuner?“ Dann antworte ich: „Weil ich ein Zigeuner bin, genauso wie diejenigen, die keine Arbeit haben und nicht studieren konnten.“
Die Kluft zwischen Europas größter Minderheit und den Mehrheitgesellschaften wird immer größer, weil Letzteren Erfahrungen und die Neugierde fehlen, sich uns zu öffnen. In Ungarn bin ich mit vielen Akademikern befreundet, die darauf bestehen, „Cigány“ genannt zu werden. Auch sie wissen mit den Begriffen „Sinti“ und „Roma“ nichts anzufangen. Aber nicht nur sie. Meine Eltern sagen immer: „Das Wort Roma ist scheinheilig. Wir sind Zigeuner. Wir haben uns niemals Roma genannt. Und dieses Wort ist so gut oder so schlecht, wie man uns behandelt.“
Erst langsam entwickelt sich bei uns Zigeunern ein ethnisches Bewusstsein. Und das ist wichtig. Genauso wichtig ist es aber, die großen Probleme zu lösen. Vor allem in Osteuropa gibt es immer noch viele Zigeunersiedlungen, in denen Menschen an den Rändern der Städte ohne fließendes Wasser und Strom leben müssen. Und es gibt Vorschläge, wie der vom ungarischen Kulturminister Zoltan Balog, die Zigeunerkinder in den Schulen von anderen getrennt unterrichten zu lassen.

ist derzeit Praktikant der gedöns.taz und Stipendiat der Robert-Bosch-Stiftung als „Medienmittler zwischen den Völkern“.
In Deutschland liegt der Fall anders. Hier ist das Wort Zigeuner vor allem durch die NS-Herrschaft diskreditiert. Die Hüter einer diskriminierungsfreien Terminologie meinen, ihre „Sinti“ und „Roma“ vor jedweder Beleidigung schützen zu müssen. Aber auch ich lebe seit über 30 Jahren in einem Staat voller Vorurteile gegenüber Zigeunern: in Ungarn. Dort ist die rechtsradikale Partei Jobbik landesweit zweitstärkste Kraft und wird von Tag zu Tag populärer.
Und trotzdem: Meine Herkunft ist meine Privatsache. Ich bin glücklich und stolz, ein echter Zigeuner zu sein – wie es in dem Lied des spanischen Flamenco-Sängers Cameron de la Isla „Soy gitano“ heißt. Aber ich bin gleichzeitig auch Ungar und Europäer. Und jetzt – ich hoffe, dass das kein Kannibalismus ist – esse ich ein Zigeunerschnitzel.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






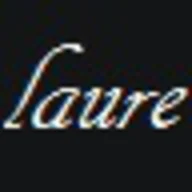

meistkommentiert