Martin Schulz’ politische Karriere: Der Europäer auf Abruf
Er startete als Provinzpolitiker. Seine Karriere in Brüssel beendete Martin Schulz als machtbewusster Präsident des Europäischen Parlaments.
Auf Deutsch, Englisch und Französisch trug der Präsident sein „Adieu“ vor – damit es auch alle Europäer mitbekommen. Es war eine Inszenierung, die nicht bloß einen Ortswechsel, sondern das Ende einer Ära markieren sollte.
22 Jahre lang hat sich der heute 61-Jährige für die EU ins Zeug gelegt, fünf Jahre hat er die Straßburger Kammer geführt. „Mehr Sichtbarkeit und mehr Glaubwürdigkeit“ – das sind die Stichworte, mit denen Schulz seine Leistung an der Spitze der Volksvertretung beschreibt.
Ein wenig Stolz klingt da mit, aber auch eine gehörige Portion Wehmut.
Schließlich war es hier, wo sich Schulz seine Statur erarbeitet hat – und nicht in Berlin, wo er nun für die SPD die Kanzlerin herausfordert. Schulz ist Deutschlands bekanntester Europapolitiker, bundespolitisch ist er ein Anfänger.
Als Hinterbänkler gestartet
Von all dem war nichts zu ahnen, als Schulz 1994 zum ersten Mal ins Europaparlament gewählt wurde. Als Hinterbänkler ist er gestartet – politische Erfahrung hatte er zuvor nur als Bürgermeister der Kleinstadt Würselen bei Aachen gesammelt.
Eigentlich wollte er kein Politiker werden, sondern Fußballprofi. Doch das klappte nicht und der junge Schulz tröstete sich im Alkohol. Schulz: „Irgendwann sagte ich mir: Entweder mache ich einen radikalen Schnitt oder ich gehe kaputt. Ich wollte mein Leben nicht wegwerfen: Mit 27 hatte ich dann meine eigene Buchhandlung, von da an ging’s bergauf“.
Credo von Martin Schulz
In Straßburg stieg der Genosse aus der Provinz schnell zum Fraktionschef der Sozialdemokraten auf. Vor allem sein lockeres Mundwerk und seine kumpelhafte Art machten ihn bekannt und beliebt. International war er aber immer noch ein Nobody – bis 2003, als Silvio Berlusconi kam.
Der italienische Ministerpräsident hielt eine Rede im Parlament und wurde von Schulz unterbrochen. Da platzte Berlusconi der Kragen: „In Italien wird gerade ein Film über die Nazi-Konzentrationslager gedreht, ich schlage Sie für die Rolle des Lagerchefs vor“, fuhr er Schulz an.
Der Eklat war perfekt, die Attacke machte weltweit Schlagzeilen. Seitdem ist Schulz ein Star. Doch hat er sich erst später, 2012, selbst erfunden. Da wurde er zum ersten Mal zum Präsidenten des Parlaments gewählt.
Schulz versprach, die Straßburger Kammer zu einem Ort der „demokratischen Debatte“ zu machen. Bisher dämmerte sie vor sich hin, nun wurde es richtig munter.
Allerdings weniger für die Abgeordneten, umso mehr aber für ihren neuen Präsidenten. Schulz lud sich selbst zu den EU-Gipfeln ein und präsentierte sich so, als stehe er selbst einem Staat vor – der Europäischen Union.
„Türsteher der Großen Koalition“
Bei der Europawahl 2014 landete Schulz dann seinen größten Coup: Er übernahm das bisher auf EU-Ebene völlig unbekannte Konzept des „Spitzenkandidaten“ – und ließ sich selbst zum ersten Frontrunner der Sozialdemokraten küren.
Das handelte ihm Hohn und Spott ein, zeigte aber Wirkung: Auch die konservative Europäische Volkspartei – in der CDU und CSU mitarbeiten – nominierte einen Spitzenkandidaten. Dass die Wahl auf Jean-Claude Juncker fiel, war Pech für Schulz, aber irgendwie auch ein Glücksfall.
Denn die beiden kannten und verstanden sich gut. Fortan konnten sie gemeinsam zur besten Fernsehsendezeit um die Gunst der Wähler streiten. Wobei der Streit eher langweilig ausfiel – in den meisten Fragen waren sich Schulz und Juncker schon damals einig, nach dem lahmen „Duell“ lagen sie sich in den Armen.
Die Nähe nutzte allerdings vor allem dem Christsozialen Juncker. Bei der Europawahl 2014 fuhr Schulz’ „Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten“ (S&D) mit 25,4 Prozent ein miserables Ergebnis ein. Die Fraktion verlor vier Sitze, Populisten und Nationalisten legten massiv zu.
Die Schulz-Show hatte nicht verfangen, Juncker wurde zum neuen Präsidenten der EU-Kommission gewählt. Danach wurde es eine Zeit lang still um den ehemaligen Buchhändler. Wenn schon nicht Kommissionschef, so wollte er nun wenigstens EU-Kommissar werden – doch Merkel sagte Nein. Dem SPD-Mann blieb nichts anderes übrig, als erneut das EU-Parlament zu übernehmen.
Wieder kungelte er mit den Schwarzen, um seine Wiederwahl zu sichern. Schulz habe sich als „Türsteher der Großen Koalition“ verstanden, schimpfte Fabio de Masi, Finanzexperte der Linken im Europaparlament. Der SPD-Mann habe dafür gesorgt, dass zwischen der Großen Koalition in Berlin und der heimlichen Allianz in Brüssel alles wie geschmiert lief.
Für Ärger sorgte auch die „G 5“, die Schulz mit Juncker aus der Taufe hob. Bis ins Detail wurden in dieser fünfköpfigen Kungelrunde in einem feinen Brüsseler Restaurant europäische Initiativen abgesprochen.
Mit Macht, ohne Handschrift
Unter Schulz’ Ägide zogen Brüssel, Berlin und Straßburg an einem Strang. Doch Grüne und Linke, die nicht in die Große Koalition eingebunden waren, hatten dabei nichts zu lachen.
Selbst die Sozialdemokraten mussten zurückstecken. Unter der Führung ihres machtbewussten Genossen konnten sie kaum eigene Akzente setzen. Im Schuldendrama um Griechenland 2015 ging die sozialdemokratische Handschrift völlig unter.
Im Wahlkampf hatte die SPD noch einen „Marshallplan für Griechenland“ gefordert. Nun trat Schulz in deutschen Talkshows auf und forderte, Premierminister Alexis Tsipras zu entmachten und eine Technokratenregierung einzusetzen.
Hinterher lud Schulz Tsipras zwar zur Aussprache ein. Doch der Bruch mit der Linken ist bis heute nicht gekittet. Profitiert hat davon ausgerechnet die EU-feindliche Rechte. Nigel Farage und Marine Le Pen haben das Parlament als Bühne genutzt – und einen Erfolg nach dem anderen eingefahren.
Genau das hat Schulz eigentlich verhindern wollen. Und dass am Ende auch noch ausgerechnet mit dem Italiener Antonio Tajani ein Berlusconi-Buddy seine Nachfolge antritt, dürfte ihn zusätzlich wurmen.
Tajani wurde mit den Stimmen von Konservativen, Liberalen und EU-Skeptikern zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Die Sozialdemokraten finden sich nach Schulz’ Abgang allein und machtlos wieder. Ein bitteres Erbe.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






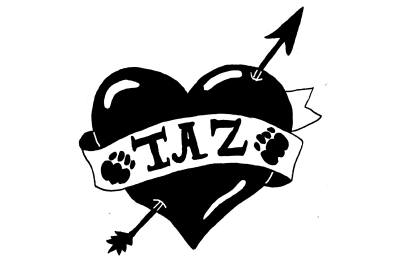
meistkommentiert
Stand der Koalitionsverhandlungen
Bitterer Vorgeschmack
Rechte Codes und Chiffren
So erkennst du rechte Sprache
Angriff auf Informationsfreiheit
Amthors Rache
Trump-Zölle auf Autos
Als Antwort einfach mal X abstellen
Die Deutschen Bahn in der Krise
Wie der Staatskonzern wieder fit wird
Illegales Autorennen in Ludwigsburg
Männer mit Mercedes im Kopf