Kommunikationsforscher über Habeck: „In keiner Weise Panikmache“
Die CDU kritisiert Aussagen zum Gas von Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) als „Panikmache“. Forscher Andreas Schwarz sieht das anders.
taz: Herr Schwarz, es gibt Kritik an der Krisenkommunikation des Wirtschaftsministers Robert Habeck. CDU-Politiker Jens Spahn sagt, Habecks andauernde Warnungen vor der möglichen Gasknappheit vergrößerten nur die Unsicherheit, Julia Klöckler spricht sogar von „Panikmache“. Sie sind Experte für Krisenkommunikation. Wie bewerten Sie Aussagen von Habeck wie „Wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten“?
Andreas Schwarz: Ich würde weniger Einzelaussagen herausgreifen, sondern das Gesamtbild der Kommunikation bewerten: Und da tut Robert Habeck sehr viel. Er ist ein sehr aktiver Kommunikator auf verschiedenen Plattformen: auf sozialen Medien und in klassischen Medien. Er wird teilweise stärker wahrgenommen als der Kanzler selbst. Aus meiner Sicht tut er genau das, was empfohlen wird: Er macht deutlich, dass es eine reale Gefahr oder Risiken gibt. Das Gas kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit knapp werden und die Preise steigen.
Zweitens macht er kontinuierlich deutlich, dass Maßnahmen auf Regierungsebene ergriffen werden, zum Beispiel mit der Reise nach Katar, den Gesprächen in Tschechien und in Österreich sowie durch diverse Abkommen.
Wieso ist das wichtig?
Die Maßnahmen dürfen nicht nur stattfinden, sie müssen auch kommuniziert werden inklusive der damit verbundenen Unsicherheit der Wirkungen. Außerdem weist er darauf hin, was die Bevölkerung im Hinblick auf Einsparung von Energie tun kann. In vergleichbarer Weise kommuniziert er auch in Richtung Industrie, die ja auch in ähnlicher Form betroffen ist.
Und gleichzeitig kommuniziert und zeigt er Empathie für die Betroffenen, für die das Risiko stärker ausgeprägt ist. Also diejenigen, die zum Beispiel niedrigere Einkommen haben und größere Probleme bekommen werden mit Gas-, Energie- und Lebensmittelpreisen.
Wie funktioniert sinnvolle Krisenkommunikation?
Das kommt auf die Krise an. Nach dem sogenannten IDEA-Modell braucht eine gute Krisenbotschaft drei Elemente: Betroffenheit klar machen und Empathie zeigen, das Risiko klar und verständlich erklären und schließlich Maßnahmen zum Schutz oder Selbstschutz erläutern und über viele Kommunikationskanäle verbreiten.
Die Regierung muss also immer zwei Ebenen kommunizieren: Zum einen, dass es eine tatsächliche Bedrohung gibt, die man ernst nehmen muss. Zum anderen sollte sie auch klar machen, dass es Maßnahmen gibt, die die Regierung ergreift oder die die Betroffenen ergreifen können. Die Bevölkerung sollte dabei auch von der Wirksamkeit der Maßnahmen überzeugt werden, wie zum Beispiel Energie sparen.
ist Co-Direktor der Internationalen Forschungsgruppe zu Krisenkommunikation (IRGoCC). Er forscht an der Technischen Universität Ilmenau.
Ist es notwendig, so häufig wie möglich Maßnahmen zu wiederholen wie Robert Habeck es tut?
Es ist wichtig, dass man immer wieder auf die steigenden Gaspreise und die Möglichkeiten zum Sparen von Energie hinweist. Jetzt sind wir noch im Sommer und niemand muss heizen, bei vielen ist die Gasrechnung noch nicht da – da können viele sehr schnell zu dem Eindruck gelangen, dass es nicht so schlimm sein kann. Insofern macht es schon Sinn, dass Habeck diese Botschaft wiederholt, damit deutlich wird, dass hier was getan werden muss.
Also teilen Sie nicht den Eindruck der Opposition, dass Habeck Panikmache betreibt?
Panikmache wäre es nur, wenn Habeck und andere in der Regierung keine Maßnahmen ergreifen und diese nicht kommunizieren würden. Das machen sie aber. Insofern sehe ich das in keiner Weise als Panikmache. Habeck versucht deutlich zu machen, dass die Gefahr da ist, dass eine Belastung auf alle zukommt und dass es Maßnahmen gibt. Auf die Risiken muss er auch hinweisen, sonst würde niemand anfangen in irgendeiner Form Energie zu sparen – weder in der Industrie noch in der Bevölkerung.
Derzeit haben wir viele Krisen gleichzeitig. Wie funktioniert Krisenkommunikation in einer solchen Situation?
In der Forschung nennen wir diese Situation auch Megakrise. Es greifen viele Krisen ineinander, es gibt multiple Ursachen und keinen einzelnen Lösungsansatz, sondern viele verschiedene Dinge, die zeitgleich getan werden müssen. Das kann die Bevölkerung überlasten: Mit Blick auf den Informationsstand und darauf, was sie eigentlich selbst tun müsste. Hier gibt es ehrlich gesagt noch keine sehr guten Erkenntnisse aus der Forschung, wie man genau damit umgehen sollte.
Als Daumenregel könnte gelten: Komplexität in der Kommunikation muss reduziert werden. Das heißt einerseits Prioritäten setzen und erst mal die Dinge angehen, auf die man unmittelbar reagieren kann. Und das ist im Moment die anstehende Energiekrise, die sich ja vermutlich zuspitzen wird. Mit Blick auf den Winter muss sich die Regierung aber auch wieder um Covid kümmern.
Offen in der Forschung ist auch die Frage, wie man die Aufmerksamkeit aufrechterhält und Themenmüdigkeit verhindert. Das ist auch für den Klimawandel eine besondere Herausforderung.
Wir haben einerseits Habeck, der sehr, sehr viel erklärt, sehr viel kommuniziert und auf der anderen Seite haben wir den Kanzler Olaf Scholz, der eher wortkarg ist. Welche Wirkung hat das, wenn der Wirtschaftsminister stärker wahrgenommen wird als der Kanzler selbst?
In ernsthaften Krisensituationen würden sich weite Teile der Bevölkerung eine Führungsrolle von den Regierenden wünschen. Da steht der Kanzler ganz oben. Der kommuniziert aber nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre, um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, dass es Maßnahmen gibt, die helfen. Da macht Habeck schon einen deutlich besseren Job. Das ist sicherlich auch eine Stil- und Persönlichkeitsfrage. Ich halte es aber in Zeiten wie diesen für die bessere Alternative, viel zu tun, sich zu kümmern und das auch zu zeigen. Und da ist der Wirtschaftsminister im Moment besser unterwegs als der Kanzler.
Am Beispiel Instagram kann man das sehr gut vergleichen. Da bekommt Habeck auch deutlich mehr Resonanz als der Kanzler. Und die Frage, warum Scholz in der Krise weniger in Erscheinung tritt, muss er sich auch kritisch gefallen lassen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

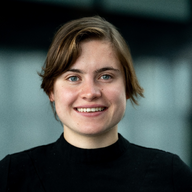





meistkommentiert
Israelische Drohnen in Gaza
Testlabor des Grauens
Proteste bei Nan Goldin
Logiken des Boykotts
Rekrutierung im Krieg gegen Russland
Von der Straße weg
Bündnis Sahra Wagenknecht
Ein Bestsellerautor will in den Bundestag
Bundeskongress der Jusos
Was Scholz von Esken lernen kann
Schwedens Energiepolitik
Blind für die Gefahren