Kolumne Afrobeat: Hammer und Machete
Nicht die Volksrepublik China, sondern das Russland von Wladimir Putin ist das Vorbild der meisten afrikanischen Autokraten.
L ange Zeit dachte man, afrikanische Staaten auf der Suche nach einem effizienten Entwicklungsmodell orientierten sich vor allem an China: straffe Einparteiendiktatur plus geplante Modernisierung. Hohes Wirtschaftswachstum, keine lästige Parteienvielfalt, dazu neue östliche Märkte und Finanzquellen als Alternative zu den ehemaligen europäischen Kolonialmächten mit ihrer ständigen Besserwisserei – das schien der Weg zu sein, von Sudan bis Simbabwe, von Äthiopien bis Angola.
Aber unter Afrikanern wurde China nie so unkritisch geliebt wie der neidische Westen dachte. Pekings ritualisiertes und kollektivistisches KP-Modell hat in Afrika keine Wurzeln geschlagen, und das zuweilen rassistische Gebaren vieler Chinesen gegenüber Afrika hat verhindert, dass menschliche Nähe entstehen konnte. Es ging immer nur ums Geld, und mit erlahmendem chinesischen Rohstoffhunger wird das Geld rar und die Freundschaft erkaltet.
Die Politik afrikanischer Autokratien, soweit man das überhaupt verallgemeinern kann, hat andere typische Merkmale. Nicht ein Kollektiv regiert, sondern ein „Big Man“, ohne dessen Zustimmung nichts geht.
Es zählt nicht Legitimität durch Verfahren, sondern durch Freundschaft und Verwandtschaft. Der Staatschef pflegt informelle Machtstrukturen, die im Zweifelsfall über mehr Gewicht, Macht und Geld verfügen als die ganzen auf dem Papier existierenden formellen Institutionen der Mehrparteiendemokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit.
Das politische Ziel ist nicht der allgemeine Wohlstand für die Bevölkerung, sondern der Machterhalt und die Lebensqualität der oberen zehn Prozent. Die verfügen über alles – die ungebildete, kranke und verelendete Bevölkerungsmehrheit kann sehen wo sie bleibt, beziehungsweise um sie darf sich die westliche Entwicklungspolitik kümmern.
Das ist die Realität Afrikas auch in so manchen Ländern, die sich nach außen als Inbegriffe strahlender Moderne präsentieren, mit Hochhäusern, Shopping Malls, privat bewachten Villensiedlungen und 4G-Internet. Die Söhne und Töchter der Elite gehen an die Spitzenuniversitäten der Welt, die Eltern in die entsprechenden Bank- und Luxusmarkenfilialen, und alle treten sie selbstbewusst „afrikanisch“ auf, wollen nicht mehr unterwürfig sein gegenüber Europäern und Amerikanern. Es ist ein neues, stolzes, zutiefst brutales Afrika.
Kampf gegen Homo- und Frauenrechte
Nicht China, sondern das neue Russland von Wladimir Putin funktioniert in allen Facetten ähnlich wie dieses neue Afrika: der kämpferische Nationalstolz; die unbekümmerte Bling-Elite; die Aushöhlung der Institutionen; die mafiösen Strukturen in Politik und Wirtschaft, die informellen Herrschaftsinstrumente unter direkter Kontrolle des Staatschefs; die Huldigung des großen Führers, der das Land zu neuer Größe gebracht hat; die Ablehnung dekadenter westlicher Liberalität, der Kampf gegen Homo- und Frauenrechte und für Tradition und Familie.
Gangsterstaaten respektieren und applaudieren einander, von Kontinent zu Kontinent. Als Russland die Krim annektierte, gab es quer durch den afrikanische Kontinent Beifall: Endlich hat es mal jemand dem Westen gezeigt. Der Griff nach der Krim war die postsowjetische Parallele zur Erstürmung weißer Farmen in Simbabwe durch Robert Mugabe, praktisch ein Desaster, symbolisch aber effektiv.
Die russische Beihilfe zum Massenmord des syrischen Regimes an der eigenen Bevölkerung – das stört niemanden in Afrikas Modernisierungsdiktaturen mit ihren Vernichtungskriegen und ihren brutalen Repressionsformen gegenüber jeglichem Protest. Wen stören in Zeiten des Syrienkrieges die paar hundert Opfer der niedergeschlagenen Demokratieproteste in Kongo, Gabun oder Äthiopien?
Die Geschichte ist dabei hilfreich. Zu Zeiten des Ost-West-Konflikts war Moskau der Freund afrikanischer Befreiungsbewegungen; ihre Kader studierten dort, fanden Aufnahme, Militärausbildung und nach erfolgreicher Machtübernahme massive Hilfe. Millionen von Menschen starben in Angola und Mosambik, Äthiopien und Somalia in den 1970er und 1980er Jahren in den Bürgerkriegen zwischen sowjetisch gestützten Diktatoren und vom Westen alimentierten Rebellen, und das wirkt bis heute nach.
Waffen und Alkohol
Das Kalaschnikow-Sturmgewehr und die Antonow-Transportmaschine sind noch heute Afrikas beliebtesten und bewährtesten Rüstungsgüter. Waffen und Alkohol – das sind zwei Dinge, ohne die kein afrikanischer Warlord durchhält und bei denen Russland bis heute führend ist. Inzwischen geht es auch um Kampfjets, Panzer und Ausspähungstechnik. Nach offiziellen russischen Angaben belaufen sich die derzeitigen Rüstungsbestellungen aus Afrika auf 21 Milliarden US-Dollar, mehr als Russlands gesamte Militärexporte im Jahr.
Russland investiert in Afrikas Rohstoffextraktion, will in Südafrika Atomkraftwerke bauen, pflegt Energiepartnerschaften mit Angola, Nigeria und Algerien, verkauft Kampfhubschrauber an Angola, Mali, Nigeria, Ruanda, Sudan und Uganda und hält regelmäßige Wirtschaftsgipfel mit afrikanischen Staaten ab. Auf dem letzten in Jekaterinburg im Juli wurde die besonders enge russisch-ägyptische Freundschaft zelebriert, der nächste Gipfel soll im Februar 2017 in Ghana stattfinden, eigentlich ein Vorzeigeland des westlichen Modells.
So entwickelt sich Afrikas politische Kultur in Richtungen, die mit westlichen Vorstellungen immer weniger zu tun haben. Putins angeblich auf der Leningrader Straße als Kind gelernte Maxime, im Falle drohenden Streits müsse man als erster zuschlagen, ist die Leitlinie jedes afrikanischen Autokraten im Kampf gegen das eigene Volk. Verbrechen zu begehen und dann alles abzustreiten war noch nie so einfach und effektiv wie heute, wo es sogar in der Ukraine und Syrien funktioniert.
Auf Russland ist Verlass, wenn man sich vor UN-Sanktionen schützen muss und wenn man lernen will, wie man Dreistigkeit zur politischen Kultur erhebt. In Russland finden Afrikas Autokraten alles, was sie brauchen, um sich auf der Schattenseite der Welt einzurichten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






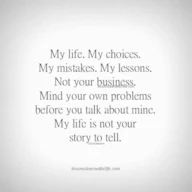



meistkommentiert
Bundeskanzler in spe
Friedrich und sein Naziopa
AfD ist gesichert rechtsextrem
Entnormalisiert diese Partei!
Nach Einstufung der AfD als rechtsextrem
Grüne und Linke wollen AfD staatliche Gelder streichen
+++ Die USA unter Trump +++
Trump startet die Woche mit extremen Plänen
Youtube-Wettrennen „The Race“
Frauen können nicht gewinnen
Die neuen SPD-MinisterInnen
Lars Klingbeil und die Neuen