Journalisten auf Kuba: Warten auf die Freiheit
Viele kubanische Journalisten hofften auf ein Ende von Menschenrechtsverstößen und Unterdrückung. Bisher vergebens.

Er sei damals auf dem Weg zur tschechischen Botschaft gewesen, erzählt Guerra, er wollte Artikel auf sein Nachrichtenportal laden. In der tschechischen Botschaft darf er umsonst ins Internet, anderswo ist es zu teuer für ihn. In den Texten ging es um Menschenrechtsverstöße der kubanischen Behörden. Um Polizisten, die Oppositionelle misshandelten und einsperrten. Um Agenten der Staatssicherheit, die kritische Journalisten wie ihn bespitzelten und bei der Arbeit behinderten.
Aber an diesem Mittwoch im Juni 2014 wird Guerra seine Artikel nicht hochladen können. Kurz vor der Botschaft nähert sich ihm ein groß gewachsener Mann. „Bist du Roberto?“ Dann schlägt der Mann zu. Guerra sinkt zu Boden. Der Mann tritt ihm gegen den Kopf, in den Bauch. Bis ein anderer befiehlt, dass es jetzt genug ist. Er beugt sich über Guerra. „Jetzt siehst du, wie es euch Oppositionellen ergeht.“ Die beiden fahren auf einem Motorrad weg. Guerra bleibt blutend auf dem Boden liegen. Für ihn war der Überfall nichts Neues. „Ich kannte den Täter sogar, er ist ein Agent der Staatssicherheit.“
Seit Guerra 2009 sein Nachrichtenportal Hablemos Press (übersetzt so viel wie: „Lasst uns reden“) gegründet hat, sei so etwas regelmäßig vorgekommen. „Mal haben sie mich in ein Auto gezerrt, mir die Augen verbunden und sind stundenlang durch die Gegend gefahren. Mal hielten sie mir eine Pistole an den Kopf. Mal sperrten sie mich tagelang ein und zertrümmerten meine Kamera.“
Wohnung ist gleichzeitig Redaktion
Guerra sitzt in seiner heruntergekommenen Einzimmerwohnung im Zentrum Havannas, als er seine Geschichte erzählt. Ein Computer mit Flachbildschirm, eine Dose Instant-Kaffee, vier rote Plastikstühle. Die Wohnung ist gleichzeitig Sitz seiner Redaktion, obwohl sie dafür eigentlich viel zu eng geworden ist. Mittlerweile hat Hablemos Press etwa zwei Dutzend Mitarbeiter. Sie berichten auch aus entlegenen Provinzen wie Guantánamo oder Holguín, mit Videos, Texten und Tonbandaufnahmen.
„Wir wollen jeden Menschenrechtsverstoß in Kuba dokumentieren“, sagt Guerra. „Jeder kann uns anrufen, dann fahren wir los und schauen, ob an der Geschichte etwas dran ist. Wenn ja, berichten wir.“ Während des Gesprächs klingelt mehrmals das Telefon.
Eigentlich sollte Guerra voller Hoffnung sein. Es ist ein Abend im Frühjahr, der 17. Dezember liegt erst ein paar Wochen zurück. Das kubanische Staatsfernsehen hatte an dem Tag Reden von Raúl Castro und Barack Obama ausgestrahlt. Die Präsidenten kündigten an, Kuba und USA wollten sich wieder annähern – nach 53 Jahren diplomatischer Eiszeit. „Wir werden uns weiter für Menschenrechte und Demokratie auf Kuba einsetzen“, hatte Obama gesagt.
Den Satz zitierte sogar die kommunistische Parteizeitung Granma. Kurz darauf ließ die kubanische Führung um Raúl Castro 53 Dissidenten frei, darunter einige Journalisten. Viele prophezeiten die Öffnung der Insel und den Beginn der Meinungsfreiheit. Aber Guerra ist schon damals skeptisch: „Ich denke, die Freilassungen sind nur ein Symbol, ein Täuschungsmanöver“, sagt er zum Abschied. „Aber ich bin bereit, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.“
Nagelfeile in den Rücken
Sechs Monate später sieht es aus, als hätte Guerra recht behalten. Kritische Medien aus Kuba und Menschenrechtsorganisationen berichten, 30 Journalisten seien seit Anfang des Jahres festgenommen worden, mehr als 1.700 Dissidenten verhaftet. Das sind mehr, als im gleichen Zeitraum 2014 festgenommen wurden – vor der Annäherung zwischen Kuba und den USA. Vor dem Tag, der alles besser machen sollte.
Der Journalist Lázaro Valle Roca ist einer von ihnen. Eines seiner Videos zeigt Polizisten, die in Havanna Lebensmittel von Händlern beschlagnahmen. Bürger bleiben spontan auf der Straße stehen und protestieren dagegen. Bei YouTube hat das Video mehr als 50.000 Klicks. Den Behörden war das offenbar zu viel. Medienberichten zufolge wurde Valle Roca zusammengeschlagen, immer wieder nehmen ihn Polizisten bei der Arbeit fest. Sie löschten seine Videos und Handyfotos.
Oder Niober García. Der Videojournalist aus Guantánamo wurde der kritischen Tageszeitung Diario de Cuba zufolge in einer Aprilnacht auf offener Straße überfallen. Ein Mitarbeiter der Staatssicherheit habe ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn dann mit einer Nagelfeile in den Rücken gestochen.
Folter und Vergewaltigungen
Tagelang lag García im Krankenhaus. Valle Roca und García sind inzwischen wieder frei. Andere können davon nur träumen. Zwei Journalisten und ein Buchautor wurden in den letzten Jahren zu Haftstrafen von bis zu 14 Jahren verurteilt, die Annäherung an die USA hat daran nichts geändert. Einer der Journalisten klagt über Folter und Vergewaltigungen im Gefängnis.
Im März klingelt Roberto Guerras Telefon. Die Stimme am anderen Ende sagt, er solle aufhören, kritisch zu berichten. „Sonst musst du sterben.“ Da beschließt er, die Repression nicht mehr hinzunehmen. Als Mitte Mai François Hollande nach Kuba kommt, sieht Guerra seine Chance. Er glaubt, dass der französische Präsident der richtige Mann ist, um den kubanischen Journalisten zu helfen. 2003 hatte Hollande, damals Parteivorsitzender der Sozialisten, in einer Zeitung die „rücksichtslose Brutalität des Castro-Regimes“ angeprangert und Pressefreiheit in Kuba gefordert.
Nun schreibt ihm Guerra einen Protestbrief. Er will, dass Hollande jetzt, als mächtiger französischer Präsident, sich daran hält, was er vor Jahren geschrieben hat, und die kubanischen Journalisten unterstützt. „Wir sind Misshandlungen und Gewalt ausgesetzt. Unsere Texte dürfen wir nicht einmal drucken“, heißt es in Guerras Brief. „Helfen Sie uns.“
Stundenlang eingesperrt
Am 10. Mai, einem Sonntag, landet die französische Präsidentenmaschine in Havanna. Es ist das erste Mal überhaupt seit der Revolution von 1959, dass ein französischer Staatschef in Kuba ist. Hollande trifft Raúl und Fidel Castro, hält eine Rede an der Universität und eröffnet den neuen Sitz der Alliance Française, einer Art französisches Goethe-Institut. Die Wirtschaftsvertreter in seinem Gefolge schließen fleißig Verträge ab: Transatlantikflüge, Hotels, Logistik. Aber Oppositionelle oder Journalisten trifft Hollande nicht. Es gibt nur ein schmallippiges Bekenntnis: Mit Rául Castro, sagt der französische Präsident, habe er auch über Menschenrechte gesprochen.
Kurz danach fliegt Roberto Guerra auf eine Konferenz nach Argentinien. Als er zurückkommt, hat er das Buch einer kubanischen Dissidentin im Gepäck. Dafür wird er stundenlang eingesperrt, der Inhalt des Buches sei schließlich „konterrevolutionär“. Zu Hause wartet die nächste Hiobsbotschaft: Sein Bruder, ebenfalls kritischer Journalist, muss bald zum Verhör bei der Staatssicherheit.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





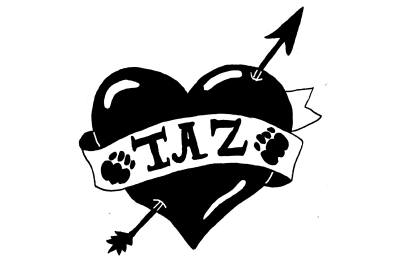
meistkommentiert
Krieg in der Ukraine
Die Ukraine muss sich auf Gebietsverluste einstellen
Essay zum Tod von Lorenz A.
Die Polizei ist eine Echokammer
Schicksal vom Bündnis Sahra Wagenknecht
Vielleicht werden wir das BSW schon bald vermissen
Tesla „Nazi-Auto“
Berlins Arbeitssenatorin legt nach
„Friedensplan“ für die Ukraine
Auch Worte aus Washington töten
Gedenken an Kriegsende in Torgau
Kretschmers Botschaft an Russlands Botschafter