Deutscher Klimaschutz in Ecuador: Öl statt Dschungel
In einem Schreiben der deutschen Botschaft in Quito setzen sich Mitarbeiter für die Ölindustrie ein. Und Minister Dirk Niebel entzieht einem Dschungel-statt-Öl-Projekt die Gelder.

Warum nur hat Dirk Niebel der linken Regierung Ecuadors einen Korb gegeben? Letzte Woche verkündete der FDP-Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit seine Entscheidung, die sogenannte Yasuní-ITT-Initiative finanziell nicht zu unterstützen. Mit Hilfe von Millionenbeträgen, die vor allem aus Ländern des Nordens kommen sollen, will Ecuador die Basis schaffen, um auf die Ölförderung im extrem artenreichen Teil des Yasuní-Nationalparks im Amazonas-Regenwald, direkt an der Grenze zu Peru, verzichten zu können.
Bislang war die deutsche Bundesregierung zumindest nach außen hin der wichtigste internationale Unterstützer des visionären Projekts, das Präsident Rafael Correa 2007, fünf Monate nach Beginn seiner ersten Amtszeit, zur Regierungspolitik erklärte. Die Ursprünge reichen aber viel weiter zurück - nämlich zu den Debatten zwischen ecuadorianischen Indígenas, UmweltaktivistInnen und Linksintellektuellen in den Neunzigerjahren.
"Nach den jahrzehntelangen Verwüstungen unseres Amazonasgebiets durch ausländische Ölkonzerne und ihre einheimischen Helfershelfer haben wir damals begonnen, über ein Post-Erdöl-Zeitalter nachzudenken", erinnert sich Mitinitiator Alberto Acosta, den Correa im Januar 2007 zu seinem ersten Bergbau- und Energieminister ernannte.
Das Projekt: Im östlichen Teil des Yasuní-Nationalparks, dem Ishpingo-Tambococha-Tiputini-Gebiet (ITT), lagern 850 Millionen Barrel (à 159 Liter) schweres Erdöl. Das entspricht 20 Prozent der Ölreserven Ecuadors oder zehn Tagen des weltweiten Ölverbrauchs. Im Juni 2007 kündigte Präsident Rafael Correa an, Ecuador werde auf die Ölförderung im ITT-Areal verzichten, wenn die "internationale Gemeinschaft" innerhalb von 13 Jahren 3,5 Milliarden Dollar aufbringt - die Hälfte des geschätzten Fördergewinns für Ecuador.
* * *
Der Fonds: Anfang August 2010 richtete das UN-Entwicklungsprogramm zusammen mit der Regierung in Quito einen Treuhandfonds ein, aus dem Umwelt- und Sozialprojekte finanziert werden sollen - die Voraussetzung für den Beginn der Einzahlungen. Bis Anfang 2012 sollen 100 Millionen Dollar eingeworben werden. Letzte Woche machte Chile mit einem Beitrag von 100.000 Dollar den Anfang.
Die neuartige Initiative, die in ihrer radikalsten Lesart mit der marktorientierten Logik des Emissionshandels bricht und damit auch mit den eingespielten Mechanismen des Kioto-Protokolls, kam jedoch langsamer voran als erhofft. Am größten war die Begeisterung bei AktivistInnen und Politikern in Großbritannien und in Deutschland - Initialzündung hierzulande war übrigens eine zweiseitige Titelgeschichte in der taz vom 4. Mai 2007.
Ein gutes Jahr später unterstützte der Bundestag das Dschungel-statt-Öl-Projekt in seltener Einmütigkeit.
Höhepunkt der deutsch-ecuadorianischen Annäherung war im Juni 2009 der Staatsbesuch des damaligen Außenministers Fander Falconí, ebenfalls ein überzeugter Ökolinker. Sein wichtigster Gesprächspartner in Berlin war Erich Stather, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).
Die Ecuadorianer erklärten höchst offiziell, dass ihnen Stather 50 Millionen Dollar pro Jahr in Aussicht gestellt habe, und zwar über einen Zeitraum von 13 Jahren. Der SPD-Mann bestritt, konkrete Zusagen in dieser Größenordnung gemacht zu haben, zudem hätten die Deutschen keine Alleingänge machen, sondern nur zusammen mit anderen Partnern der Europäischen Union einsteigen wollen.
Sie habe die Yasuní-Initiative "immer außerordentlich unterstützt", sagte die damalige BMZ-Chefin Heidemarie Wieczorek-Zeul" jetzt der taz, "diese Initiative ist doch beispielhaft in ihrem Verzicht auf die Ölförderung und dem Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten".
Doch schon damals versuchte die Öllobby kräftig, Ecuadors Vorzeigeprojekt zu torpedieren. Auf offene Ohren stießen sie in der deutschen Botschaft in Quito. Der bislang klarste Beleg dafür ist das der taz vorliegende Dokument, das eilfertige Diplomaten am 9. Februar 2009 als "Fernschreiben (verschlüsselt)" nach Berlin schickten.
In dem "DB" (Drahtbericht) erörtern sie "Vor- und Nachteile der Ölförderung" im Yasuní-Nationalpark am Beispiel des spanischen Ölmultis Repsol, der im Jahr 2000 die Konzession über den Block 16 zugesprochen bekam, ein 3.000-Quadratkilometer-Areal mitten im Regenwald. Dafür wurden sogar die Grenzen des Yasuní-Parks nach Osten verschoben.
Anders als der "mangels ausreichenden Personals schwache" ecuadorianische Staat, der "auch mit umfassender, gerade in der betreffenden Region endemischer Korruption zu kämpfen" habe, setzten die Spanier "den Schutz des betreffenden Gebiets auch durch", heißt es anerkennend, und zwar angeblich mit Billigung der Huaorani-Indígenas, "deren Territorium wohl nur so […] geschützt werden" könne.
Das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Die Huaorani-Aktivistin Manuela Ima schilderte im letzen Jahr der taz die "andere Seite": "Seit den Sechzigerjahren sind die Multis dabei, unsere Kultur zu zerstören", sagte die Vorsitzende des Huaorani-Frauenverbands.
"Bei der Ausbeutung der Ölreserven geht Repsol ebenso vor- wie umsichtig zu Werke", loben hingegen die deutschen Diplomaten nach einer zweitägigen, vom Petromulti organisierten Stippvisite. Aus ihrer Sicht stellen nicht die ausländischen, hochmodernen Ölkonzerne, sondern die Indígenas die Bedrohung des Nationalparks dar.
"Da die Huaorani Halbnomaden sind, also den Park auch durch Rodungen belasten, wird irgendwann der Punkt erreicht werden, an dem die Regenerationszeit für die Flora zum Engpassfaktor für das ökologische Gleichgewicht werden wird", sagen sie voraus. "Dann wird eine Güterabwägung zu treffen sein zwischen dem Schutz des Waldes und dem Schutz der Lebensweise einer ethnischen Gruppe." Repsols Vorgehen zeige, "dass es möglich ist, das Öl in einer Weise zu fördern, welche den Park nicht auf Dauer in seiner Substanz angreift und den jetzt dort lebenden Huaorani langfristig die Lebensgrundlage erhält".
Und sie schließen mit der "überraschenden (!) Überlegung, dass es de facto im Sinne des Schutzes von Park und dessen Ureinwohnern zumindest auf mittlere Sicht sinnvoller sein kann, eine Ausbeutung der Ölvorkommen im Park […] zu ermöglichen."
Der Yasuní-Fan und FDP-Bundestagsabgeordnete Harald Leibrecht hat die Hoffnung auf eine erneute Kehrtwende seines Parteifreunds Dirk Niebel noch nicht aufgegeben. Ebenso wenig die ecuadorianische Regierung: "Wir müssen sehen, was in den nächsten Tagen passiert", meinte Vizeaußenminister Kintto Lucas am Dienstag.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
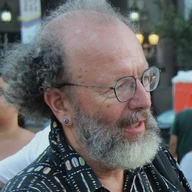




meistkommentiert