Buch über Antirassismus: Eine Analyse rassistischer Kampfzonen
Weder individuelle Therapie noch Bildungsseminar: Achim Bühl erklärt in seinem Buch, weshalb Antirassismus so sein muss.
Der Rassismus ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das Strukturen und Institutionen ebenso wie Handlungen und Ideologien umfasst“. Achim Bühls Definition des Rassismus in seinem Buch „Anatomie eines Machtverhältnisses“ kann man sich nicht oft genug vergegenwärtigen. Denn Rassismus ist nicht einfach Ideologie, persönliche Haltung oder Meinung, es liegt ihm stets ein Machtverhältnis zugrunde.
„Der Rassismus ist immer primär Rassismus der Gesellschaft und nicht Handlungsweise extremistischer oder krimineller Elemente“, schreibt der Soziologe. Durch ihn konnten Millionen von Afrikanern auf die Plantagen der Karibik verschifft und gnadenlos ausgebeutet werden, Millionen Juden von den Nazis vernichtet, Milliarden von kolonisierten Indern, Afrikanern, Indios entwertet und enteignet werden.
„Der Rassist spaltet die Gesellschaft in eine ‚Wir-Gruppe‘ und eine ‚Fremdgruppe‘, um mittels der sozial konstruierten Gruppenbildung eine Vorrangstellung aufrechtzuerhalten, die ihm soziale, ökonomische wie kulturelle Extragewinne verspricht.“ Ein Machtverhältnis, das man in unterschiedlichen Ausprägungen überall auf der Welt findet: Christen gegen Juden, Weiß gegen Schwarz, Hindus gegen Muslime, Araber gegen Afrikaner usw.
Bühl liefert eine differenzierte und umfassende Analyse rassistischer Kampfzonen. Das ist sein Verdienst. Auch die Kampfzone Alltag durchleuchtet er: „Der Alltag ist das vorrangige Kampffeld des rassistisch Dominierenden, um mittels der rassistischen Karte seine Ressourcen gewinnbringend zu optimieren“, schreibt Bühl. Er bringt Beispiele aus Kinderbüchern, Kinderreimen, historischen Reiseberichten, aber auch Straßenbezeichnungen mit heute als rassistisch verpönter Namensgebung.
Beispielsweise die Mohrenstraße in Berlin. Sie ist nach schwarzen Musikern des preußischen Heeres benannt. 1721 verkaufte Friedrich Wilhelm I. die preußischen Afrika-Annexionen an die niederländische Westindien Kompanie. Zusätzlich zur Kaufsumme waren „12 Negerknaben“ zu stellen. Fast niemand kennt heute die koloniale Geschichte der Mohrenstraße.
Der antirassistische Kampf gegen den Straßennamen wird daher von vielen als übertriebener Antirassismus belächelt. Und leider verliert sich auch Bühls akribische Analyse des Rassismus bei der Auseinandersetzung mit dem Alltagsrassismus im schematischen Dogma, das eigentlich seiner Analyse widerspricht: „Insofern der Rassismus ein gesellschaftliches Verhältnis ist, ist der Antirassismus ein politischer wie sozialer Kampf und keine individuelle Therapie oder ein Bildungsseminar.“
Rassismus: Anatomie eines Machtverhältnisses. Marix Verlag, Wiesbaden 2016. 315 Seiten, 15 Euro.
So wirkt es aber schnell, wenn jedes historisch gewachsene Bild, auch wenn es rassistischen Ursprungs ist, zu empörter Schnappatmung führt und auf den Index kommt. Worte wie „Rasse“, „Mohr“ oder „Indianer“ sind auch Zeitzeugnisse. Sie zu benutzen mag heute unachtsam sein. Sie mit der antirassistischen Moralkeule zu ahnden führt aber letztlich nur zur Tabuisierung, und das ist genau das Gegenteil von Aufklärung.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







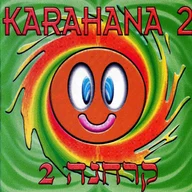
meistkommentiert