Buch „Die gute Regierung“: Maschinenkönige
Von der Französischen Revolution bis heute: Der Historiker Pierre Rosanvallon liefert eine Grundlage, um die Demokratiekrise zu verstehen.
„Unsere politischen Systeme könnten als demokratisch bezeichnet werden, doch demokratisch regiert werden wir nicht.“ So steigt der französische Historiker Pierre Rosanvallon in den vierten und letzten Band seiner umfassenden Demokratieanalyse ein.
Im Zentrum steht dabei zunächst die Frage, wie sich die Gewaltenteilung seit Ende des 18. Jahrhunderts in Europa und den USA entwickelt hat und welche Rolle der Exekutive in unterschiedlichen Zeiten zugeschrieben wurde.
Das Ziel des französischen Historikers ist keineswegs akademisch, sondern politisch: Rosanvallon will eine Grundlage liefern, um die Rolle gegenwärtiger Regierungen und das damit verbundene Demokratiedefizit fundiert beschreiben zu können. Angesichts des sich rasant ausbreitenden Populismus und der Dringlichkeit, dem politisch entgegenzuwirken, ist das ein wichtiges Anliegen.
Nach einem fulminanten Einleitungskapitel zeichnet der Autor, leider manchmal recht langatmig, die sich wiederholenden Pendelbewegungen bei der Rollendefinition demokratischer Regierungen nach. Den führenden Köpfen der Französischen Revolution schwebte eine unpersönliche Herrschaft des Rechts vor: Die für alle gleichen Gesetze sollten bestmöglich fürs Gemeinwohl sorgen.
Vom allgemeinen Wahlrecht zum Antiparlamentarismus
Die Regierung war als ausführendes Organ ohne wesentlichen Handlungsspielraum konzipiert – ein „maschineller König“, der die parlamentarischen Entscheidungen umsetzt. Doch eine Kodifizierung stieß im Alltag schnell an Grenzen, und wenig später lag die Macht in der Hand eines einzelnen Mannes, der mit vielen Leuten sprach und dann allein entschied: Napoleon.
Mit der Herausbildung von Parteien schlug das Pendel erneut zurück: Wählergruppen orientierten sich nun an ihrem sozialen Status; als Führungspersonal wurden meist relativ schwache Persönlichkeiten ausgewählt, schreibt Rosanvallon.
Außerdem wurde in der Zeit zwischen den Weltkriegen wirtschaftliches und technokratisches Denken dominant für Politik und Verwaltungen: Den Erfolg von Regierungen lasen die Wähler in Kennziffern wie Arbeitslosenquoten ab.
Ausgerechnet nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts machte sich aber auch ein zynischer Antiparlamentarismus breit. Im Nationalsozialismus sollte das Volk seine eigene Souveränität in der Glorifizierung der Exekutive und der Abkehr vom Repräsentativsystem erleben.
Per Los ausgewählte Bürger
Nach der Zeit der Diktatur kehrten Deutschland und Italien jeder Personalisierung von Macht zunächst den Rücken; Parteien und Parlamente dominierten die Politik. In Frankreich dagegen setzte Charles de Gaulle 1962 mit einer Volksabstimmung durch, dass die Bevölkerung ihren Präsidenten direkt wählen kann.
Seit drei Jahrzehnten breitet sich dieser Trend einer erneuten Fokussierung auf das Führungspersonal in vielen Ländern aus, derweil Parteien zunehmend zu „Hilfstruppen des Exekutivbetriebs“ werden. Ihre Funktion als Vermittler zwischen Gesellschaft und politischen Institutionen haben sie immer stärker eingebüßt.
Viele Bürger fühlen sich heute von ihren Regierungen missachtet, belogen und ausgetrickst – und von den Parlamenten nicht mehr repräsentiert. Eine Reaktion darauf ist eine rasant wachsende Zustimmung zu populistischen Parteien wie AfD und PiS in Polen – oder die Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump.
Rosanvallon setzt dem die Perspektive einer „Betätigungsdemokratie“ entgegen, die er nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts als die zweite demokratische Revolution empfiehlt. Er will die Beziehungen zwischen Regierenden und Regierten enthierarchisieren durch Transparenz, Rechenschaftspflichten, Kontrolle und eine ernsthafte Erörterung gesellschaftlicher Fragen auf Augenhöhe.
Pierre Rosanvallon: „Die gute Regierung“. Hamburger Edition, Hamburg 2016, 376 Seiten, 35 Euro
Dafür schlägt er neue Institutionen vor wie einen Rat für den demokratischen Prozess. In Fachkommissionen für solidarisches Zusammenleben oder Bildung sollen neben Experten auch per Los ausgewählte Bürgern sitzen, die Probleme ernsthaft und umfassend analysieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Dieser letzte, besonders spannende Perspektiventeil kommt in dem Buch leider deutlich zu kurz.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





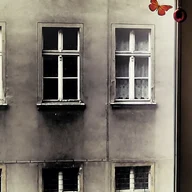
meistkommentiert