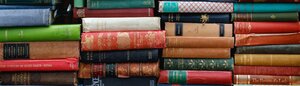Ethikrat: Tausche Schleich-Pferd gegen Handy
Was tun, wenn das Kind die Freude an Design-Handys entdeckt? Der Ethikrat setzt pädagogische Maßstäbe, die man fast nur verfehlen kann.

Die elfjährige Tochter möchte ein Designerhandy: Ist sie nicht immun gegen Statussymbole? Foto: Britta Pedersen/dpa
Kürzlich kam ich aus einem Paketshop, als ich den Ethikrat auf einer Bank auf der anderen Straßenseite sitzen sah. Der Ethikrat, das sind drei ältere Herren von geringer Größe, die mir gelegentlich Hinweise in Fragen praktischer Ethik geben. Als ich näher kam, sah ich, dass der Vorsitzende neben einem winzigen Greis saß. Der Greis trug einen Hut, unter dem er nahezu verschwand, und der Ratsvorsitzende hielt seine Hand. Neben der Bank stand ein Rollator von der Größe eines Puppenwagens.
„Darf ich Ihnen meinen Vater vorstellen“, sagt der Vorsitzende und wies auf mich. „Das ist Frau Gräff.“ Der Greis lächelte und zog seinen Hut. „Guten Tag“, sagte ich geehrt und verlegen. Ratsmitglieder, Kolleg:innen oder Feinde in ihrer Eigenschaft als Familienmitglieder zu sehen ist erhellend, es macht sie in etwa so verletzlich wie Leute, die man beim Schlafen betrachtet.
„Ich möchte Sie nicht aufhalten“, sagte ich, aber der Ratsvorsitzende wehrte ab: „Keinesfalls“, sagte er. „Vielleicht möchten Sie uns eine philosophische Fragestellung vorlegen?“ Ich war überrascht, weil der Vorsitzende oft nur am Rande an meinen Fragen interessiert war, aber dann sah ich den wohlwollenden Blick, mit dem der Greis auf seinen Sohn sah, und raffte mich zusammen. „Ich habe gerade das Päckchen weggebracht, in dem meine Tochter ihre Schleich-Pferde verkauft“, sagte ich. „Sie möchte Geld verdienen, um ein Handy zu kaufen, das wir ihr nicht bezahlen. Aber weil man als Elfjährige nicht kellnern kann, bleibt nur etwas bei uns zu Hause als Einnahmequelle. Ich möchte sie aber nicht fürs ganz normale Helfen bezahlen. Und extra gibt es nicht viel zu tun.“
„Man nennt es wohl Selbstwirksamkeit“
Ich stoppte. Meine Fragestellung war zu banal, um das Attribut philosophisch zu verdienen. „Was ich meine, ist: Ich möchte unseren Haushalt nicht in eine kleinkapitalistische Geldmaschine verwandeln. Aber ich sehe auch, dass das Kind die Möglichkeit haben sollte, etwas zur Erfüllung eines Wunsches beizutragen. Man nennt es heute wohl Selbstwirksamkeit.“
Er lächelte, und vermutlich war es das, was mich auf die Palme brachte
Der Ratsvorsitzende nahm eine große Tasche, aus der er eine karierte Wolldecke zog, die er sorgfältig über die Beine seines Vaters legte. Dann wandte er sich mir zu. „Ich möchte Sie an Epiktet erinnern“, sagte er. „Der Erfordernisse des Leibes wie Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung nimm dich an, soweit das einfache Bedürfnis reicht, was aber dem Schein und dem Wohlleben dient, das streiche ganz.“ Er lächelte, und vermutlich war es das, was mich auf die Palme brachte. „Wollen Sie sagen, dass ich zu wenig Anstrengungen unternehme, um mein Kind immun gegen Statussymbole zu machen?“, fragte ich. „Und ist nicht andererseits digitale Abstinenz das Statussymbol eines verunsicherten Bildungsbürgertums?“
Der Ratsvorsitzende schien das Interesse an der Fragestunde zu verlieren. „Möchtest du etwas Tee, Vater?“, wandte er sich an den Greis und holte eine Thermoskanne aus seiner Tasche. „Ich habe auch Kekse gebacken“, sagte er und zog eine zerbeulte Dose hervor, in der dunkle Klumpen lagen. Ich fühlte mich überflüssig und setzte mich auf eine Nachbarbank, um das Ausmaß von Schein und Wohlleben in meiner Familie abzustecken.
Da hörte ich das Geräusch von schleifenden Rädern. Es war der Vater des Ratsvorsitzenden, der sehr langsam mit seinem winzigen Rollator näher kam. „Ich bitte um Nachsicht mit meinem Sohn“, sagte er und legte seine schmale Hand auf meinen Arm. „Immer und immer sage ich ihm, dass er sich von Epiktet lösen muss. Für die Ontologie der Digitalität braucht es einen neuen Blick.“ Er zog einen Keksklumpen aus einem Fach des Rollators und bot ihn mir an. „Danke“, sagte ich. „Er meint es ja gut.“