Nonne über ihr Leben im Kloster: „Man braucht Kraft, durchzuhalten“
Maria Burger ist eine von sechs Nonnen des Karmels auf der Elbinsel Finkenwerder, einem Kloster der Karmelitinnen. Sie erzählt von ihrem Leben in der Stille.
taz: Schwester Maria, warum sind Sie Nonne geworden?
Maria Burger: Als ich mit meinem Studium fertig war und angefangen habe, zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich noch mehr will. Mein Beruf war mein Beruf, aber ich suchte eine Berufung. Als ich dann ins Kloster eingetreten bin, war ich 31. Im Jahr 2014 bin ich dann in unser Kloster hier in Hamburg gekommen.
Was haben Sie gearbeitet?
Ich habe Medizin studiert und drei Jahre lang als Ärztin gearbeitet.
Sie haben sich für einen kontemplativen Orden entschieden, in dem das Beten und die Beziehung zu Gott im Vordergrund stehen. Fehlt Ihnen da nicht der Aspekt, anderen Menschen zu helfen?Ich habe mir verschiedene Klöster angeschaut und war auch bei den missionsärztlichen Schwestern. Das lag ja nahe. Ich dachte auch immer, wenn man als Ärztin ins Kloster geht, dann geht man in die Dritte Welt. Ich habe mich mit der Vorstellung aber nie wohlgefühlt. Ich hätte es nicht begründen können, aber irgendwas passte für mich nicht. Trotzdem war es keine leichte Entscheidung, den Beruf aufzugeben. Das war ein Kampf für mich. Als ich dann im Kloster war, habe ich die Arbeit komischerweise nie vermisst.
Warum haben Sie sich für die Karmelitinnen entschieden?
Für welchen Orden man sich entscheidet, das ist so eine Frage wie die, welchen Mann man heiratet. Mir hat damals jemand gesagt, das muss passen wie ein Schüssel ins Schloss. Eingetreten bin ich 1997 in ein Kloster unseres Ordens in Hessen. Ich wusste damals, entweder ich probier’s und trete ein oder ich werde immer bedauern, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich habe es eigentlich nie bereut.
Wirklich nie?
Es gab mal Momente, in denen ich am liebsten getürmt wäre. Aber da wusste ich, ich laufe vor etwas davon, dem ich mich besser stellen sollte.
Was war das?
Für mich war irgendwann die Frage: Bin ich eigentlich gewollt? Ich glaube, das ist etwas, das sich jeder Mensch fragt. Ich musste dann dahin kommen, zu sagen: Gott will mich und deswegen darf ich mich selbst auch wollen.
Braucht man die Bestätigung nicht auch von anderen Menschen?
Ich glaube, es braucht beides. Zum einen die Annahme durch die Freundschaft, aber auch, sich von Gott angenommen zu fühlen.
Wie sieht Ihr Alltag aus?
Der Tag ist gefüllt mit den Gebetszeiten: Morgens von sieben bis acht stilles Gebet, dann das Psalmgebet, Arbeitsbesprechung, Frühstück, Arbeitszeit, wieder eine Zeit Stille in der Kirche. Um zwölf Psalmgebet, dann Mittagessen, um 17 Uhr wieder Psalmgebet, abends eine Stunde stilles Gebet und unter der Woche anschließend noch die Eucharistiefeier.
Und das jeden Tag?
Fast. Zweimal im Monat machen wir Stilletage. Und einmal im Monat haben wir einen freien Tag.
Fahren Sie dann in die Stadt oder gehen ins Kino?
In die Stadt fahren wir selten. Das mache ich nur, wenn ich wirklich was brauche. Am freien Tag gehe ich spazieren oder fahre Fahrrad. Ich habe dann das Bedürfnis nach Natur, Bewegung, frischer Luft.
Was machen Sie während der Arbeitszeit?Jede macht das, was sie gut kann. Ich arbeite zum Beispiel gerne im Garten und kümmere mich um unsere Seniorin, die ist 94 Jahre alt. Es fallen Hausarbeiten an, wir betreuen die Gäste, führen Begleitungsgespräche und dann der ganze Verwaltungskram. Momentan schlagen wir uns mit der neuen Datenschutzverordnung rum, das ist wirklich viel Arbeit.
52, hat drei Jahre lang als Ärztin gearbeitet. Mit 31 ist sie in den Orden der Karmelitinnen eingetreten. 2014 kam sie in das Kloster nach Finkenwerder. Dort ist sie aktuell die Oberin, die für drei Jahre gewählt wird.
… ein Schnittpunkt mit dem „normalen“ Leben.
Ja. Es gibt alle Probleme, die es außerhalb des Klosters gibt, auch innerhalb. Wir leben nicht auf einem anderen Stern. Für uns ist das hier ein ganz normales Leben.
Wovon leben Sie?
In erster Linie von den Gästen. Manche von ihnen kommen nur für einen Tag, andere bleiben eine Woche oder zehn Tage. Die meisten sind aus Hamburg. Wir hatten zum Beispiel einen Lehrer zu Besuch, der nach Schuljahresende einfach ein paar Tage schweigen wollte. Der war nicht im Gottesdienst und das ist auch okay für uns. Wir machen keine Vorschriften.
Ist das Klosterleben streng?
Es braucht natürlich eine gewisse Konsequenz. Aber heute gehen einige Dinge, die früher gar nicht gegangen wären. Die Mutter einer Mitschwester lebt in den USA. Sie wird sie in nächster Zeit besuchen.
Was gefällt Ihnen an diesem Leben?
Besonders die zwei Stunden inneres Gebet und die Stilletage. Da kommt es darauf an, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, den wir in uns glauben. Manchmal bekommen wir auch die Erfahrung geschenkt, dass er wirklich da ist.
Wie merken Sie das?
Es ist schwer zu beschreiben. Das ist ein tiefer Frieden, tiefes Glück und für mich in erster Linie ganz große Dankbarkeit. Es gibt dann natürlich auch immer wieder Durststrecken. Da muss man die Kraft finden, durchzuhalten. Das ist schwierig, aber es lohnt sich.
Haben Sie sich vor Ihrer Zeit im Kloster viel mit Gott beschäftigt?
Ich bin katholisch aufgewachsen, aber eine wirkliche Gottesbeziehung habe ich erst gefunden, als ich ein Jahr lang in einer freikirchlichen Gemeinde gelebt habe. Am Anfang der Zeit im Kloster musste ich herausfinden, ob der Ort wirklich passt. Wir haben sechs Jahre, bis wir uns endgültig festlegen.
Durften Sie da auch Zweifel äußern?
Ja, das ist sehr wichtig.
Was würden Sie am Klosterleben gerne verändern?
Da fällt mir so direkt nichts ein. Woran man natürlich immer arbeiten kann, sind die Beziehungen untereinander.
Ersetzt die Gemeinschaft für Sie eine Familie?
Es ist schon ein sehr enges Zusammenleben wie in der Familie, wo es mit der einen gut geht und mit der anderen weniger gut. Wir sind aber nicht miteinander aufgewachsen.
Sind Sie trotz der Gemeinschaft manchmal einsam?
Auch das kann passieren. Man kann ja auch in einer Ehe sehr einsam sein.
Was sagt Ihre richtige Familie zu Ihrem Leben im Kloster?
Meine Mutter hatte zwei Tanten im Kloster, die da sehr glücklich waren. Deswegen ist es ihr relativ leicht gefallen. Aber das kann natürlich auf großen Widerstand stoßen. Ich weiß von einer verstorbenen Mitschwester, dass ihr Vater den Kontakt abgebrochen hat. Das hat sich auch nie wieder eingerenkt.
Und Ihr sonstiges Umfeld?
Ich habe das letzte halbe Jahr vor meiner Zeit im Kloster in England gearbeitet. Wenn ich da gesagt habe, ich gehe ins Kloster, war zwei Minuten lang betretenes Schweigen und dann wurde das Thema gewechselt. Es ist unterschiedlich, je nachdem, was die Leute für eine Vorstellung vom Klosterleben haben. Da haben ja manche ganz fürchterliche und gruselige Vorstellungen.
Haben Sie viele Kontakte außerhalb des Klosters?
Für mich ist es in erster Linie die Gemeinschaft hier. Aber natürlich habe ich auch Kontakte nach außen. Die pflege ich telefonisch, per Brief oder per Mail. Besuch kommt ab und zu, aber selten. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Das ist zwar nicht weit, aber seit der Zeit in Hessen haben die Leute sich das irgendwie abgewöhnt.
Finden Sie das schade?
Für mich ist das schon okay. Manchmal denke ich, es wäre schön, wenn sie ein bisschen mehr wüssten oder wenn mal wirklich jemand käme. Ich habe eine Schulfreundin, die angekündigt hat, dass sie mich demnächst besuchen kommt, seitdem ich im Kloster bin. Aber irgendwie kriegt sie die Kurve nicht.
Denken Sie manchmal darüber nach, was sie machen könnten, wenn Sie nicht hier wären?
Wirklich drüber nachdenken nicht. Ich denke manchmal, es wäre schön, einen Wanderurlaub auf Kreta zu machen. Aber ich vermisse hier nichts.
Können Sie das nicht?
Wir machen das nicht. Es geht schon mal jemand in Erholung für ein paar Tage oder Wochen und wir machen Exerzitien, also Stilletage. Da bleibe ich nicht hier, sondern gehe in ein anderes Kloster. Wir haben hier Internet und bekommen Mails, die wir beantworten müssen. Da bin ich dann wirklich zehn Tage ohne Telefon, ohne alles. Und das ist sehr befreiend.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






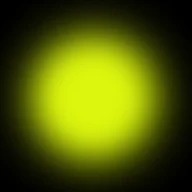
meistkommentiert
Grüne blockieren Milliardenpaket
Nö, so nicht
Leitantrag für Linken-Parteitag im Mai
„Kultur der revolutionären Freundlichkeit“
Trump-Regierung gegen Uni-Proteste
Ex-Anführer von Gaza-Protesten in den USA festgenommen
Absatzeinbruch bei Tesla
Als gäbe es gar keine Probleme
Sondierungen von Union und SPD
So nicht, sagen die Grünen
Ergebnis der Sondierungen
Auf dem Rücken der Schwächsten