Abaton-Programmchef über Abschied: „Ich glaube an die Kraft des Kinos“
Vor über 30 Jahren startete Matthias Elwardt als Kartenabreißer im Abaton Kino. Zum Ende des Jahres wird der langjährige Programmchef gehen.
Herr Elwardt, Sie kamen früh zur Leinwand und waren schon als Schüler in der Film-AG. Haben Sie jemals überlegt, etwas anderes zu machen?
Matthias Elwardt: Lustigerweise ja. Ich bin damals drei Jahre Schülersprecher gewesen. Und parallel dazu hatte ich einen Lehrer im Mathe-Leistungskurs, das war so ein frischer 68er. Der hat mit mir zusammen die AG gemacht. Es gab dann zum Beispiel ein Polanski-Festival. „Ekel“ und „Rosemary's Baby“, für Schüler eigentlich nicht wirklich geeignet. So hat mich Kino interessiert, aber genau so hat mich auch die Schule interessiert. Wir haben mit dem Abi-Zeugnis eine offizielle Warnung vom Kultusministerium Schleswig-Holstein bekommen. Da stand drin, wir sollten nicht Lehrer werden, weil es zu viele Lehrer gibt. Deshalb bin ich das nie geworden. Ich hätte mir Mathe und Geschichte als Lehrer vorstellen können.
Sie haben im Studium anschließend selbst Filme gedreht.
Ich hatte einen Kurzfilm, der lief bei dem Vorläufer des Hamburger Kurzfilmfestivals. Ich habe aber gemerkt, dass ich immer nur Kunsthandwerker geblieben wäre. Beim Schnitt dachte ich irgendwann – ich muss nicht Filmemacher werden.
Im Abaton sind Sie dann ab Mitte der 80er-Jahre zwar nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber doch vom Kartenabreißer zum Geschäftsführer und Programmchef mit 27 Jahren aufgestiegen.
Ich habe das große Privileg gehabt, dass ich als Student einen Job bekommen habe. Angefangen habe ich am 20. Februar 1986, als „Ganz Unten“ von Günter Wallraff anlief. Der damaligen Programmchefin Hella Reuters habe ich etwas später die Idee des „Bloomsday“ nähergebracht. Den habe ich 1988 gestartet, also vor dreißig Jahren.
Den „Bloomsday“ gibt es im Abaton jedes Jahr am 16. Juni zum Gedenken an den Tag der Handlung in James Joyces Roman „Ulysses“. Die Hauptfigur Leopold Bloom ist Namensgeber. Sie zeigen die Verfilmung und es gibt begleitende Lesungen sowie das „Bloomslunch“ mit Gorgonzola-Sandwich und Rotwein. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Das ist schwierig. Ab Anfang Juni wird das Foyer umgebaut und dafür leider auch der 35mm-Projektor geopfert. Finde ich sehr schade, aber das ist nicht meine Entscheidung. Die einzige „Bloomsday“-Kopie auf 35mm, die es gibt, liegt bei uns im Keller. Die kann man dann nicht mehr zeigen. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das etwas vorziehen. Digital gibt es nur die englische Fassung, das ist bei Joyce natürlich nicht so einfach.
55, geboren in Lübeck, ist seit 1990 Programmchef und Geschäftsführer des vielfach ausgezeichneten Hamburger Programmkinos Abaton. Vor drei Jahren schied er nach einem Rechtsstreit mit der Gründerfamilie als Gesellschafter aus. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg.
Aktuell machen Netflix und andere digitale Anbieter den Kinos Konkurrenz, indem sie Filme exklusiv produzieren. Wie erleben Sie diesen Umbruch?
Wir haben im Augenblick genug Filme, ich sehe da keinen Mangel. Das ist dann einfach so. Netflix ist auch eigentlich ein amerikanischer Serienabspieler. Da sind deutsche und europäische Geschichten ja reine Feigenblätter. Netflix hat Adam Sandler unter Vertrag – so what?
Adam Sandler bringen Sie eher nicht.
Nein, die Filme laufen bei uns sowieso nicht. Ich glaube, dass es ein Publikum gibt, das den kulturellen und sozialen Ort Kino wahrnimmt und genießt. Wir haben in Hamburg annähernd 50 Prozent Singles. Das Kino ist ein wichtiger Ort zum Treffen, Verabreden und Kennenlernen.
Netflix macht Ihnen also keine Sorgen?
Nein, ich glaube an die Kraft und die Vielfalt des Kinos.
Vor Kurzem wurde bekannt, dass Sie nach fast 30 Jahren als Programmchef zum Ende des Jahres das Abaton verlassen werden. Weshalb gehen Sie?
Eigentlich habe ich nicht so Lust, darüber viel zu erzählen. Die Familie Grassmann hat mir meinen Geschäftsführervertrag gekündigt, weil die Söhne es selber machen wollen. Ganz einfach. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen über den Kinomietvertrag sind über mehrere Jahre gegangen. Was soll ich da mehr zu sagen?
Werden Sie dem Abaton denn in einer Form verbunden bleiben?
Nein, das ist eine klare Trennung. Ich führe Gespräche und gucke einfach mal, was ich 2019 mache. Das muss nicht zwangsläufig in Hamburg sein, das kann Kino sein, muss es aber nicht. Ich bin da offen und optimistisch. Meine Tochter studiert und mein Sohn geht auf das Abi zu. Meine Freundin würde auch an andere Orte mitkommen, da bin ich also nicht gebunden.
Ihre Nachfolger, Philip und Felix Grassmann, wollen das Abaton in Zukunft „digitaler“ gestalten. Hat das Abaton hier Nachholbedarf?
Ich glaube, es geht darum, dass sie zum Beispiel den Newsletter in anderer Form verschicken wollen. Im Digitalen passiert ja immer mal was, aber das bezieht sich jetzt nicht auf die Kinovorführung oder so. Dass es neue Software gibt, um den Newsletter zu verschicken oder diesen auch zu individualisieren – ja, das kann man machen.
An welche Erlebnisse erinnern Sie sich gerne zurück?
Viele Regisseure bezeichnen das Abaton als ihr Wohnzimmer, da gibt es sehr oft Verbindungen bis zum allerersten Film. Den ersten Kurzfilm von Fatih Akin habe ich im regulären Programm als Vorfilm gezeigt. Von Fatih haben wir alles gezeigt, der ist zu allen Veranstaltungen auch gekommen. Bei „Kurz und Schmerzlos“ habe ich ihn eingeladen, im Anschluss einen Film seiner Wahl zu zeigen. Ich habe „Scarface“ vorgeschlagen, das ist ja der Kultfilm bei „Kurz und Schmerzlos“. Fatih hat den dann vorgestellt und ich gucke in den Saal und sehe am Montagabend 200 – ich sage mal in Anführungsstrichen – Altonaer Türken. Als ich den Film mit ihnen gesehen habe, wurde mir klar, dass „Scarface“ eine Migrationsgeschichte erzählt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





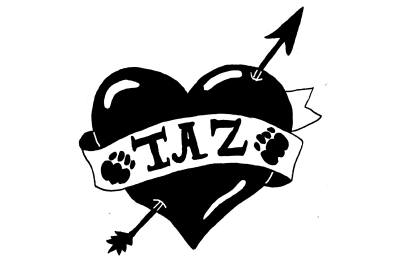
meistkommentiert