Angriffe auf Reporter*innen: Journalismus ist kein Einzelkampf
Ein neuer Report zeigt, dass Journalist:innen in Deutschland immer mehr körperliche Angriffe erleben – und enger werdende Diskursräume.
I m Trenchcoat mit fester, bestimmter Stimme, sich allein mit Notizblock oder Kamera den Weg durch Menschenmengen bahnend, immer auf der Suche nach der besten Story – und das natürlich erfolgreich und mit Beifall vom Publikum. So wird er oft in Filmen dargestellt, der typische Reporter. Der einsame Held mit Haltung, unermüdlich, zäh, manchmal zynisch, aber immer im Dienst der Wahrheit.
So romantisch ist die Welt des Journalismus aber leider nicht (mehr). Viel zu oft werden Reporter:innen an ihrer Arbeit gehindert und sogar angegriffen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) gibt dazu seit 2015 jährlich Zahlen heraus: 89 Angriffe auf Journalist:innen wurden 2023 gezählt – doppelt so viele wie im Vorjahr, in dem es noch 41 waren. 75 davon waren körperlich: Tritte, das Bewerfen mit Gegenständen, Einschüchterung auf offener Straße.
Deutschlandweit geraten Medienschaffende in Gefahr – besonders, wenn sie über rechtsextreme oder verschwörungsideologische Versammlungen berichten. RSF nennt Berlin einen „Brennpunkt“, weil dort besonders viele Übergriffe registriert wurden. Eine weitere Auffälligkeit: Ein Großteil der Angriffe ereignete sich am Rande von Nahost-Demonstrationen. Allein 40 Prozent aller Attacken richteten sich gegen zwei Reporter, die dort regelmäßig berichten – und regelmäßig zur Zielscheibe werden.
Verändert sich gerade das Bild von Journalist:innen? „Viele Bürgerinnen und Bürger betrachten Medienschaffende mittlerweile als Feinde“, sagt Katharina Viktoria Weiß, RSF-Referentin für Deutschland. Ein Satz, der schwer wiegt – und ein gefährliches Klima beschreibt. Denn es geht nicht mehr nur um Tritte oder Wurfgeschosse.

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
RSF beschreibt eine weitere, schleichendere Bedrohung: den enger werdenden Meinungskorridor, besonders seit dem 7. Oktober 2023. Journalist:innen, die über Israel und Palästina berichten, sehen sich zunehmend mit massiven Einschränkungen konfrontiert. Begriffe müssen mit Redaktionen abgestimmt werden, Kritik an der israelischen Kriegsführung werde kontrolliert oder vermieden. Palästinensische Quellen, selbst internationale Organisationen wie Amnesty International oder die Vereinten Nationen würden infrage gestellt – während Informationen des israelischen Militärs oft ungeprüft übernommen würden.
Wer berichtet, wird zunehmend als Feind gesehen. Die Öffentlichkeit wird härter, die Kommentare feindseliger. Hasskampagnen in sozialen Medien nehmen zu. Redakteure wie Nicholas Potter (taz) oder TV-Reporterinnen wie Sophia Maier sind nur zwei Beispiele für Medienschaffende, die unter massiven Online-Angriffen leiden.
Viele Journalist:innen berichten RSF inzwischen von wachsender Angst: Angst vor Bloßstellung in anderen Medien, auf Social Media, vor Doxing und gezielter Hetze. Die Folge: Manche meiden im Zweifel bestimmte Versammlungen ganz. Die Dunkelziffer ist hoch. Die Pressefreiheit bröckelt – und das in einem Land, das sich zu ihr bekennt.
Was also tun? Journalist:innen müssen im Feld besser geschützt werden, insbesondere durch die Behörden, wenn sie in gefährliche Situationen geraten. Pressefreiheit darf kein Nebenthema sein, sondern muss politisch priorisiert werden. Auch Arbeitgeber:innen stehen in der Verantwortung: Sie müssen Ansprechpersonen bereitstellen, psychologische Betreuung und juristischen Beistand anbieten – und das ausdrücklich auch für freie Mitarbeitende, die durch keine Tarifverträge abgesichert sind. Ein bereits geschaffener Schutzkodex, entwickelt von Verdi und anderen 2022, muss aktiv umgesetzt und weiterentwickelt werden. Zudem braucht es umfassende Sicherheitstrainings – nicht nur für die Auslandsberichterstattung, sondern auch im Inland, wo Lokaljournalist:innen zunehmend ins Visier geraten.
Doch es geht nicht nur um rechtliche und organisatorische Maßnahmen. Es geht auch um Atmosphäre, um Offenheit, um Vertrauen. Viele Medienschaffende haben das Gefühl, sie könnten beim Thema Nahost nicht offen und ausgewogen über das Leid aller Seiten berichten. Solche Gefühle gehören auf den Tisch – in Redaktionskonferenzen, in informellen Gesprächen, im Austausch unter Kolleg:innen. Dafür braucht es Räume. Räume für Unsicherheit, für Reflexion, für echtes Zuhören. Denn Journalismus ist kein Einzelkampf, auch wenn er oft so inszeniert wird.
Die Figur des Lone-Wolf-Reporters war immer schon mehr Film als Realität. Es ist Zeit für einen solidarischen Journalismus, der Haltung zeigt, der sich gegenseitig schützt, der nicht nur den Mächtigen gegenüber mutig ist, sondern auch intern offen und ehrlich. Einen Journalismus, der sich seiner Rolle erinnert: die Gesellschaft zu informieren, aufzuklären, die Demokratie zu schützen. Einen Journalismus, in dem niemand Angst haben muss, seinen Job zu machen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






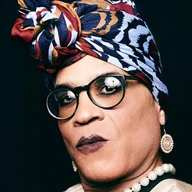

meistkommentiert