Album „Ali“ von Nene H: Harte Arbeit
Nene H hat ihr Debütalbum „Ali“ veröffentlicht. Noise und Harmonien, Geboller und erhabener Gesang gehen darauf gemächlich im Nirvana auf.

Moment, ist das etwa ein Rhythmus? Ein Beat gar? Von links nach rechts, von oben nach unten pendelt der Sequenzer, dann setzt sogar ein Geklöppel ein, das sich kunstvoll um sich selbst windet, aber trotzdem: Bis „We Wait“ tatsächlich Club-Tauglichkeit entwickeln könnte, ist es noch ein weiter Weg.
Aber dann: das vorwärtsdrängende „The Hustle“, spartanisch und effektiv, wenige exotische Schlieren, der Beat kurz vorm Überschnappen, aber zugleich kontrolliert, mechanisch und doch lebendig – ein Track, an dem man hängen bleibt, weil er so gar nicht nach Techno klingt, aber dann doch ganz eindeutig ist.
Die in der Türkei geborene und dort in einer traditionellen Familie aufgewachsene Klangkünstlerin, die sich mal Nene H, mal Nene Hatun nennt nach einer türkischen Freiheitskämpferin, lebt in Kopenhagen und Berlin. Die Gefahr, auf einem mitteleuropäischen Tanzboden demnächst auf einen ihrer Tracks zu treffen, ist zwar wegen Corona unwahrscheinlich.
Aber wenn sich das Leben wieder normalisiert haben sollte, könnte es passieren, dass man dem einen oder anderen der Stücke ihres eben erschienenen ersten Albums „Ali“ mal morgens um vier Uhr begegnet. Das Mixmag-Magazin nannte Nene H einen „breakout star“, ihre DJ-Sets „hypnotisierend“.
Nene H: „Ali“ (Incienso Records)
Residency in Kopenhagen
Genauso gut aber funktioniert ihre Musik auf Avantgarde-Festivals, spielt sie doch ebenso versiert mit den Konventionen des Hörspiels wie mit den Versatzstücken der elektronischen Clubkultur. Folgerichtig legt sie auch schon mal auf im Berghain und besitzt eine Residency im angesagten Kopenhagener Club Endurance.
Aber ihre womöglich wichtigsten Auftritte hatte sie in den beiden vergangenen Jahren bei den Berliner Festivals Atonal und CTM, wo sie – wie als visuelle Verlängerung ihrer Musik, die sich beständig zwischen zwei Kulturen, zwischen Tradition und Moderne bewegt – einmal im Hijab hinter ihrem Equipment stand. Ein Jahr später erarbeitete sie mit einem achtköpfigen Chor aus Georgien schon eine Auftragsarbeit fürs CTM.
Mit der Musik begonnen hat Beste Aydın, wie Nene H im bürgerlichen Leben heißt, einst als klassisch ausgebildete Pianistin, die im zarten Alter von elf Jahren Rachmaninoff spielte und sieben Jahre lang in Stuttgart Komposition studierte, bevor sie sich nach ihrem Umzug 2015 nach Berlin der Elektronik zuwandte, mit Techno und Industrial experimentierte, Noise- und Dark-Wave-Elemente, die türkischen und aserbaidschanischen Harmonien, mit denen sie aufgewachsen ist, oder religiöse Gesänge aus Tibet integrierte.
Von jenen spirituellen Chants zog Aydin eine direkte Linie zu den harten Beats Berliner Clubs: „It’s techno. It’s fucking techno“, sagte sie damals in einem Interview mit Resident Advisor: „Es ist genau dasselbe Gefühl.“
Gebete in Songs verarbeitet
Diese Idee greift sie auf „Ali“ ebenfalls wieder auf in Tracks wie „Gebet“, in dem sich über einem stumpfen Geboller ein erhabener Gesang so lange selbstzufrieden im Kreis dreht, bis er gemächlich im Nirvana aufgeht.
Grundsätzlich aber entfernt sich Aydın mit ihrem Debütalbum entschieden vom Dancefloor. „Ali“ ist ein Konzeptalbum, in dessen acht Tracks sie den Tod ihres Vaters verarbeitet. Die mal türkischen, mal deutschen Texte, die mal eher Klang als Inhalt sind, mal dräuend von Trauer und Verlust erzählen, bilden im Zusammenspiel mit der Musik, die konsequent zwischen den Polen Techno und türkische Musik hin und her pendelt, eine zusätzliche Ebene, auf der sich Nene H mit dem Leben zwischen zwei Kulturen auseinander setzt.
Dass diese Auseinandersetzung nicht immer harmonisch abläuft, dass sie mitunter anstrengend ist, das kann man der Musik anhören. „Ali“ ist keine Klangtapete, keine Hintergrundmusik, kein Soundgebimmel für eine hippe Ausstellungseröffnung, sondern harte Arbeit – auch für den Hörer und selbst, wenn dann doch mal der Beat einsetzt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen




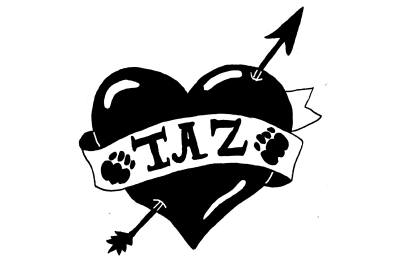
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!