Ukrainischer Patriarch ausgebürgert: Metropolit Onufrij soll Verbindung zu Moskau haben
Der ukrainische Geheimdienst entzieht dem Erzbischof der ukrainisch-orthodoxen Kirche den Pass. Er soll auch die russische Staatsbürgerschaft haben.

Von einer Behörde wie dem ukrainischen Geheimdienst SBU ist nicht unbedingt christliche Nächstenliebe zu erwarten. Jetzt erwischte es Onufrij – mit bürgerlichem Namen Orest Beresowskyj und seines Zeichens Metropolit (Erzbischof) der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche, kurz: UPZ, früher mit dem Namenszusatz Moskauer Patriarchiat. Einer entsprechenden Erklärung des SBU vom Mittwoch ist zu entnehmen, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Oberhirten per Dekret die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen habe.
Laut SBU unterhalte Onufrij weiterhin Verbindungen zum Moskauer Patriarchat. Er widersetze sich bewusst dem Versuch der ukrainischen Kirche, eine kanonische Unabhängigkeit von Moskau zu erlangen. Dessen Vertreter, vor allem der Patriarch Kyrill, unterstützen offen die russische Aggression gegen die Ukraine. Zudem soll Beresowskyj 2002 zusätzlich zur ukrainischen freiwillig auch die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben, ohne die zuständigen ukrainischen Behörden zu informieren.
Die UPZ war zunächst Teil der Russisch-Orthodoxen Kirche. Am 27. Mai 2022 erklärte sie ihre „völlige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit“ von Moskau, vollzog diesen Schritt jedoch nicht im streng kirchenrechtlichen Sinne. Man verurteile den russischen Überfall auf die Ukraine und appelliere an die Ukraine und Russland, den Verhandlungsprozess fortzusetzen, hieß es. Im August 2024 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, das diese Kirche verbietet. Derzeit sind in mehreren Gemeinden Rechtsstreitigkeiten anhängig.
Onufrij, der aus einer Priesterfamilie stammt, wird am 5. November 1944 in einem Dorf bei Tscherniwzi in der Westukraine geboren. Dem Abitur folgt eine technische Ausbildung. 1969, nach dreijährigem Technikstudium in Tscherniwzi, geht der heute 80-Jährige nach Moskau, wo er seine Hochschulausbildung an der Moskauer Geistlichen Akademie im zweiten Studienjahr fortsetzt. 1972 wird Onufrij Priester, 1990 Bischof von Tscherniwzi und der Bukowina. 2000 erhält er den Titel Metropolit. Im August 2014 wird er von einer Bischofsversammlung der UPZ zum Metropoliten von Kyjiw und der ganzen Ukraine gewählt.
Fünf Monate zuvor annektiert Russland die Krim – ein klarer Bruch des Völkerrechts. Ein zeitgleicher Appell Onufrijs, auf diesen Schritt zu verzichten, verhallt ungehört. Immer mal wieder tritt Onufrij für ein Ende des Krieges in der Ostukraine ein, weigert sich aber im Mai 2015, bei einer Rede des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko im Parlament aufzustehen, als Zeichen eines Anti-Kriegs-Protestes.
2023 berichtet das Webportal Ukrainska Prawda erstmals über Onufrijs russischen Pass. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe er die russische Staatsbürgerschaft behalten und einen ukrainischen Pass erhalten, erläutert Onufrij damals. Die russische Staatsbürgerschaft habe sich automatisch verlängert. Dafür sei niemand verfolgt worden, da beide Staaten gute Beziehungen unterhalten hätten.
Der Sprecher der UPZ, Metropolit Kliment, erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen ukrainischen Rundfunk Suspilna, Onufrij besitze keinen anderen Pass als den ukrainischen – weil er nie aktiv einen Antrag auf eine andere Staatsbürgerschaft gestellt habe. Kliment zufolge sei die Entscheidung zur Aufhebung der Staatsbürgerschaft „mit gewissen rechtlichen Zweifeln behaftet“. Onufrij werde gegen Selenskyjs Dekret Berufung einlegen und so seine Rechte als ukrainischer Bürger schützen. Der Religionskrieg in der Ukraine geht damit in die nächste Runde.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





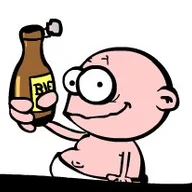
meistkommentiert
Dobrindt will Gespräche mit der Taliban
Abschieben für die AfD
Israels Pläne für Gaza und die Westbank
Deutschland bleibt Komplize
Geplantes Primärarztmodell
Ist da wirklich was, Frau Doktor?
Dobrindt will mit Taliban sprechen
Deutschlands „Migrationswende“ wird am Hindukusch verhandelt
Schwarz-rotes Stromsteuer-Fiasko
Vertrauen im Eiltempo verspielt
Ein Jahr Pflicht für Tethered Caps
Befreit die Deckel!