Internet-Professor über Vergessen: „Nicht Perfektion, sondern Pragmatik“
Internet-Experte Viktor Mayer-Schönberger fordert: Google soll den Weg zur gesuchten Webseite erschweren, aber nicht verhindern.

Google erinnert sich – auch ohne Links Bild: imago/ecomedia/robert fishman
taz: Herr Mayer-Schönberger, wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) muss Google jetzt Links löschen. Entspricht dies Ihrer Vorstellung von einem Recht auf Vergessenwerden?
Viktor Mayer-Schönberger: In meinem Buch „Delete“ hatte ich über die Wichtigkeit des Vergessens geschrieben, und gefordert, dass wir dem Vergessen etwa durch ein Ablaufdatum an Information wieder eine Chance geben. Ich hatte aber auch geschrieben, dass Individualrechte, wie etwa das Recht auf Vergessen, so inhaltlich richtig sie auch sein mögen, oftmals an der fehlenden Bereitschaft der Menschen scheitern, ihre Rechte auch wenn notwendig vor Gericht einzufordern. Insofern hatte ich keine großen Erwartungen an das - in dieser Form bereits in der Datenschutz-Richtlnie der EU vor 20 Jahren - enthaltene „Recht auf Vergessen“. Ich erwartete aber auch, dass aufgrund der konkreten Sachlage der EuGH so urteilen würde.
In den vergangenen Tagen hat Google mit dem Auslisten von Texten britischer und deutscher Medien aus ihren Suchergebnissen begonnen. Zeigen diese Fälle nicht, dass das Recht auf Vergessenwerden eben doch in scharfer Konkurrenz zu Meinungs- und Pressefreiheit stehen können?
Nein, das denke ich nicht. Denn schon im Anlassfall vor dem EuGH hat schon die spanische Datenschutzbehörde die Klage gegen das Online-Medium mit dem Hinweis auf die Meinungsfreiheit verworfen. Google wurde verurteilt, weil Google ausdrücklich im Verfahren angegeben hat, dass Google kein Medium ist und die Suchergebnisse auch kein Ausdruck der Meinungsfreiheit sind, sondern vollautomatische Ergebnisse eines Algorithmus. Da konnte dann der EuGH die in der Datenschutz-Richtlinie enthaltene Ausnahmeregelung für Zwecke der Meinungsäußerung nicht anwenden. Insoweit ist das Ergebnis für Google auch hausgemacht. Dass Google jetzt in der Implementation ebenfalls so schlimm daneben greift ist finde ich erschütternd.
Ist es glücklich, dass die Entscheidungen, ob einem Antrag auf Vergessenwerden stattgegeben werden kann, nun in den Händen des Privatkonzerns Google liegt?
Aus wirtschaftlicher Sicht hat Google ein hohes Interesse möglichst wenig Inhalte zu vergessen, denn sonst verlieren die Menschen das Vertrauen in die Suchmaschine - und damit käme Google in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Insofern gibt es (jedenfalls theoretisch) einen ausreichend starken Mechanismus der internen Kontrolle. Ich habe die Hoffnung, dass sich nach einer tumultuösen Anfangsphase die Verfahren in diesem restriktiven Sinn einspielen werden.
Welchen Einfluss hat Ihrer Ansicht nach die Tatsache, dass Google-Suchergebnisse personalisiert sind, individuell an die prognostizierten Interessen des Suchenden angepasst?
Das ist schwer zu sagen, weil wir den Grad der Personalisierung nicht kennen. So gibt es eine Studie aus den USA, nach der die Personalisierung kaum unterschiedliche Ergebnisse liefert, die Behauptung der „Personalisierung“ also vor allem ein Marketinginstrument von Google ist. Hier brauchen wir mehr Daten, um klarer zu sehen.
Der Politik- und Internet-Professor lehrt am Oxford Internet Institute und war zuvor an der US-Eliteuniversität Harvard tätig. Er forscht zu gesellschaftlichen und politischen Problemen im digitalen Zeitalter. Zuletzt veröffentlichte der gebürtige Österreicher das Buch „Delete. The Virtue of Forgetting in the Digital Age“.
In einem Interview sagten Sie, dass eine Information, die in einer Google-Suche nicht mehr auftaucht, von 99 Prozent der Bevölkerung nicht mehr gefunden werden kann und somit faktisch gelöscht ist. Also geht es am Ende um nicht mehr als einen digitalen Sichtschutz für Informationen, obwohl sie tatsächlich noch im Netz existieren?
Ja. Es geht um eine Art digitale Bremsschwelle und darum, dass wir nicht mehr über diese Suchergebnisse geradezu stolpern, sondern etwas gezielter danach suchen müssen. Früher musste man auch in Archive von Zeitungen um alte Berichte auszugraben. Selbst mit dem Recht auf Vergessen muss ich nur bei Google.com suchen, um auch „vergessene“ Ergebnisse wieder angezeigt zu bekommen. Das erfordert gerade einmal zehn Sekunden an Mehrarbeit - und ist eine ganz kleine Hürde - aber vielleicht ausreichend genug, dass wir im täglichen Suchen nur dann bei Google.com nachsuchen, wenn es uns wirklich wichtig erscheint. Das mag die richtige Richtung einer Balance von Erinnern und Vergessen zeigen.
Die Seite hiddenfromgoogle.com sammelt Links zu ausgelisteten Texten und führt auch die Namen derer auf, die mutmaßlich auf diese Auslistung gedrängt haben. Durch den Streisand-Effekt könne man eben keine Informationen aus dem Netz tilgen, sagen Kritiker des Rechts auf Vergessen. Was entgegnen Sie?
Es geht nicht um Perfektion, sondern um Pragmatik - also darum, dass Ergebnisse in aller Regel nicht auf den ersten zwei, drei Ergebnisseiten erscheinen. Und der Streisand-Effekt lebt eben gerade davon, dass wir etwas als erinnerungswürdig einstufen - genau das sollte aber für die meisten Fälle des Rechtes auf Vergessens nicht zutreffen. Das Argument geht also ins Leere - ganz abgesehen von der empirischen Zweifelhaftigkeit des Streisand-Effekts.
Ergibt es angesichts immer neuer Meldungen über Datensammlungen der NSA überhaupt noch einen Sinn, sich der unbegrenzten Auffindbarkeit von Daten über die eigene Person entgegenzustemmen?
Ja. Natürlich. Wir dürfen nie aufgeben. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Ein Rechtsbruch wird ja nicht dadurch „geheilt“, dass ich aufgebe dagegen anzukämpfen.
Abgesehen von Google, welcher Weg ist Ihrer Ansicht nach für die Durchsetzung eines Recht auf Vergessenwerdens vielversprechender: Gesetzliche Regelungen oder Privacy-By-Design-Lösungen wie Snapchat?
Ich habe eine Präferenz für Lösungen, die von den Nutzerinnen auch einfach angenommen werden können. Privacy-by-design ist da der falsche Begriff, denn es geht primär nicht um die technische Umsetzung (die ist zumeist trivial), sondern darum, dass am Markt entsprechende Nachfrage nach Privatheit der Menschen auch durch ein entsprechendes Angebot befriedigt werden kann. Das bedeutet vor allem auch Monopolen entgegen zu wirken (und dort wo es sie gibt diese jedenfalls datenschutzrechtlich klar in die Verantwortung zu nehmen), und die Nachfrage durch gezielte Aufklärung der Menschen zu fördern.




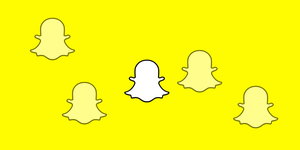

Leser*innenkommentare
Christian
Warum steht ein Artikel über Pariser Post-it-Wars auf dem Google-Index? War's das schon so schnell mit der Theorie von der strengen Kontrolle? http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/aug/30/paris-post-it-wars-french