Südafrikanischer Präsident in den USA: Trump demütigt Ramaphosa im Weißen Haus
Der US-Präsident bedrängt seinen südafrikanischen Amtskollegen mit Vorwürfen zu einem weißen „Genozid“. Sein grotesker Stil fällt auf ihn selbst zurück.

Trump hat es sich inzwischen zur Gewohnheit gemacht, seine Staatsgäste im Weißen Haus zu brüskieren. Ramaphosa war darauf jedoch offensichtlich nicht vorbereitet. Er wollte mit Trump über Handelsbeziehungen sprechen und Südafrikas Sicht auf die Weltpolitilk erläutern. Was als diplomatisches Treffen angekündigt war, mutierte in ein peinliches Spektakel.
Ramaphosas Besuch soll eigentlich die Spannungen zwischen Südafrika und den USA beenden. Wiederholt hat Trump behauptet, Südafrikas weiße Farmer seien Opfer eines „Genozids“. Er hat im Streit darüber Südafrikas Botschafter ausgewiesen und weißen Südafrikanern Asyl in den USA angeboten. Gerade erst wurde eine erste Gruppe aufgenommen, kurz vor dem da bereits festgelegten Termin für Ramaphosas Visite.
Südafrikas Regierung hat Trumps Behauptungen immer standhaft zurückgewiesen und widerlegt: die Morde an weißen Farmern, die es tatsächlich gibt, sind keine gezielte ethnische Auslöschung, sondern Teil der allgemeinen Eskalation schwerer Gewaltverbrechen, die alle Südafrikaner trifft. Schwarze und weiße Farmer sind gleichermaßen von Gewaltverbrechen betroffen, belegen die Kriminalitätsstatistiken der südafrikanischen Polizei und unabhängiger Forscher.
Streit um Landreformpolitik
Für eine systematische Kampagne gegen weiße Landbesitzer gibt es keine Anzeichen. Südafrikas Rechtsstaat schützt das Eigentumsrecht; die Landreformpolitik der regierenden ehemaligen schwarzen Befreiungsbewegung ANC (African National Congress) versucht, historische Ungerechtigkeiten anzugehen, ohne Personen aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit zu benachteiligen.
Denn obwohl die Apartheid, während der ausschließlich Weiße in Südafrika Bürgerrechte genossen, 1994 fiel, genießen weiße Südafrikaner bis heute ökonomische Vorteile. Sie halten weiterhin einen überproportionalen Anteil an Südafrikas Land – in etwa 50 Prozent – im Vergleich zur schwarzen Mehrheitsbevölkerung. Die ANC-Politilk der „affirmative action“, die Schwarze etwa bei der öffentlichen Auftragsvergabe bevorzugt, sollte der fortdauernden Ungleichheit entgegenwirken. Strukturelle Ungleichgewichte in Bildungschancen, Zugang zu bezahlter Arbeit und Unternehmensbesitz existieren jedoch weiter.
Das Erbe der Apartheid bringt es mit sich, dass etablierte weiße Großgrundbesitzer den besten Zugang zu Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, etablierten Abnehmern und moderner Technologie bewahrt haben. Ihr Wohlstand vererbt sich, damit bleibt ihre Vorherrschaft in der Landwirtschaft über die Generationen erhalten. Schwarze Farmer hingegen haben es oft schwer, Land zu erwerben, Kredite zu erhalten und technische Unterstützung zu bekommen.
Landreformprogramme haben ein wenig Land umverteilt, aber ansonsten nichts geändert. Dazu kommt bürokratische Ineffizienz, Langsamkeit und Korruption. Die meisten schwarzen Farmer sind Kleinbauern, die für den Eigenverbrauch produzieren und nicht über das Kapital verfügen, um in die kommerzielle Landwirtschaft zu expandieren, etwa in den lukrativen Agrarexport. Das Gefälle zwischen reichen Weißen und armen Schwarzen besteht besonders auf dem Land fort.
Ramaphosa betont Bereitschaft zu konstruktivem Dialog
Vor diesem Hintergrund konnte Trumps Video-Stunt Ramaphosa nur verblüfft und frustriert zurücklassen. Er konnte bloß entgegen, dass Südafrika ethnische Gewalt nicht gutheißt und dass Malemas Rhetorik nicht die Regierungspolitik darstellt. Südafrikas Präsident betonte seine Bereitschaft zu konstruktivem Dialog statt aufwiegelnder Vorwürfe.
Wie peinlich all das war, war offensichtlich. Es war nicht anders als Trumps Empfang für den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sich ebenfalls Vorwürfe und Forderungen anhören musste. In Trumps erster Amtszeit hatten schon Theresa May, Emmanuel Macron und Angela Merkel Trumps Umgang aushalten müssen.
Mit jedem dieser Vorfälle verstärkt sich der Eindruck, dass Diplomatie für Trump vor allem Spektakel ist, nicht Substanz. Seine Neigung, Gäste zu demütigen, weckt Sorgen über den Ruf der USA in der Welt. Man könnte sagen, dass solche Auftritte ernsthafte Gespräche über Handel, Sicherheit und internationale Zusammenarbeit untergraben. Ramaphosa wollte die Beziehungen Südafrikas zu den USA gerade im wirtschaftlichen Bereich verbessern; stattdessen wurde er zum neuesten Opfer von Trumps Spektakeldiplomatie.
Es gibt offensichtlich viel zu reparieren zwischen beiden Ländern, und es besteht ein Bedarf an nuancierter Diskussion über Südafrikas Geschichte und Gegenwart. Mit der Überwindung von Ungleichheit in Südafrika tun sich alle Regierungen seit Ende der Apartheid schwer. Trumps Umgang damit lenkt von der Arbeit ab, die in diesem Bereich nötig ist, und verstärkt den Eindruck, dass er nicht in der Lage ist, internationale Diplomatie mit der Würde und dem Taktgefühl auszuüben, die man vom Führer einer Weltmacht erwartet.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





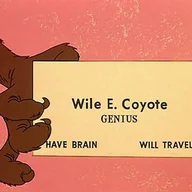

meistkommentiert
Jüdische Studierendenunion
„Die Linke hört nicht auf die Betroffenen“
Friedrich Merz und Israel
Außenkanzler, verschließt Augen und Ohren
Günstiger und umweltfreundlicher
Forscher zerpflücken E-Auto-Mythen
Arbeitszeitbetrug-Meme
Arbeitgeber hassen diesen Trick
Indischer Schriftsteller Pankaj Mishra
„Gaza hat die westliche Glaubwürdigkeit untergraben“
Israelisches Militär im Westjordanland
Auch Deutscher unter beschossenen Diplomaten