Streit um Anti-Rassismus-Klausel: Oberhausen macht weiter Theater
Das Kollektiv Technocandy wollte eine Anti-Rassismus-Klausel im Vertrag. Jetzt wird immerhin über Rassismus geredet – nur nicht miteinander.

Ein taz-Interview mit dem Theaterkollektiv Technocandy hat das Theater Oberhausen in eine Krise gestürzt. Seit Tagen diskutieren Vertreter*innen des Hauses und der Stadt über die Anti-Rassismus-Klausel, die Regisseurin Julia Wissert und die Juristin und Dramaturgin Sonja Laaser erdacht haben.
Die Vertragsklausel, sagt in dem Interview Kollektivmitglied Frederik Müller, solle einen Umgang bieten, wenn in der Produktionszeit rassistische Vorfälle passierten. Wenn so etwas geschehe, müsse das Haus reagieren und einen Workshop oder eine andere Art von Intervention folgen lassen. Bleibe diese Intervention aus, habe die Regie das Recht, die Produktion platzen zu lassen, ohne Schadenersatz zu zahlen.
Der Konflikt über diese Klausel hat sich so weit zugespitzt, dass es nach der Premiere von Technocandys Stück „Schaffen“ am vergangenen Freitag – ohne Vertragsunterzeichnung – minutenlange Buhrufe eines Ensemblemitglieds gab, und Intendant Florian Fiedler sich im Deutschlandfunk öffentlich für die Klausel aussprach. Damit stellte er sich gegen seinen Verwaltungsleiter Jürgen Hennemann.
Apostolos Tsalastras weiß, wie struktureller Rassismus aussehen kann. „Ich bin seit 15 Jahren in dieser Verwaltung und manche können meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen“, sagt der Oberhausener Kulturdezernent.
In Bochum kein Problem
Dass eine Diskussion um Rassismus jetzt mit dem Stadttheater eine Institution aus seinem Wirkungskreis betrifft, wurmt ihn trotzdem: „Das Thema ist bei uns eigentlich ganz oben. Wir erstellen gerade mit allen Kultureinrichtungen Handlungskonzepte, um mehr Diversität zu erreichen.“ Eine Anti-Rassismus-Klausel in Theater-Verträgen findet er trotzdem „problematisch“: „Ich glaube, Selbstverpflichtungen greifen besser, als wenn man hinterher vor Gericht ziehen muss, um zu klären, ob man es mit einem rassistischen Vorfall zu tun hat oder nicht.“
Nach Julia Wissert solle die Klausel gerade kein Anlass für Gerichtsverfahren sein oder einzelne Personen an den Rassismus-Pranger stellen. „Wir wollten ein Werkzeug schaffen, das Einladung zum Dialog ist“, sagt Wissert. Die Regisseurin, die Schwarz ist, hat in ihrem Berufsleben eine Menge Erfahrungen mit strukturellem Rassismus gemacht. „Rassismus heißt eben nicht nur, dass Skinheads Schwarze auf der Straße zusammenschlagen, sondern bedeutet auch, dass Zugänge verwehrt werden, dass eine Person wie ich praktisch jeden Tag ‚geothered‘ wird.“
Deshalb hat sie gemeinsam mit Sonja Laaser die Klausel erfunden – „auch um einen Weg zu finden, meinen Körper und meine Psyche zu schützen.“ Sie greift, wenn eine an einer Produktion beteiligte Person sich von einer Äußerung durch Mitarbeitende betroffen fühlt, die einen Bezug zu der in der Klausel klar beschriebenen Definition von Rassismus hat.
Bei Produktionen von Julia Wissert haben zum Beispiel das Schauspielhaus Bochum oder das Staatstheaters Hannover die Klausel akzeptiert. Der Betriebsrat eines Hauses kam sogar auf sie zu, weil er gern einen ähnlichen Passus in die Verträge aller Mitarbeiter*innen aufnehmen würde. „Die Klausel führt dazu, dass die Rolle, über strukturellen Rassismus aufzuklären, nicht nur den Betroffenen zukommt, sondern dass dieser Punkt nun bei den Institutionen liegt“, sagt Wissert.
Wer welche Karte zieht
Am Theater Oberhausen bleibt die Verwaltung bei der Ablehnung: „Eine solche Klausel benachteiligt einen Partner unangemessen“ – nämlich das Theater. Der freie Vertragspartner könnte jederzeit „die Rassismus-Karte ziehen“, lässt sich Verwaltungsleiter Jürgen Hennemann in der WAZ zitieren.
Florian Fiedler sagte dagegen im Deutschlandfunk: „Ist man bereit, anzuerkennen, dass unsere Gesellschaft an sich – und nicht einzelne Theater – strukturell rassistisch ist aufgrund der Geschichte, die wir haben? Und wenn man bereit ist, das anzuerkennen, dann kann so eine Klausel natürlich auch helfen als Zeichen dafür, dass man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen.“
Kulturdezernent Tsalastras ist zwar optimistisch, den Streit im Haus wieder zu befrieden. Daran, dass die Gruppe Technocandy noch einen Vertrag inklusive Anti-Rassismus-Klausel bekommt, glaubt er jedoch nicht: „Da will keiner das Gesicht verlieren und wir werden für wahrscheinlich auf Grundlage der mündlichen Vereinbarung weiter zusammenarbeiten.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





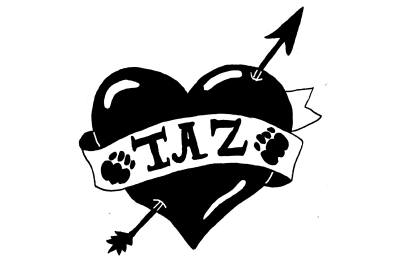
meistkommentiert
Trumps Kampf gegen die Universitäten
Columbia knickt ein
Letzte Generation angeklagt
Was sie für uns riskieren
„Friedensgespräche“ in Riad
Die Verhandlungen mit Russland sind sinnlos
Verkehrsvolksentscheid in Paris
Vortäuschende Partizipation
Rüstungsausgaben
2,5 Milliarden für eine Whatever-it-takes-Fregatte
Ergebnis der Abstimmung
Pariser wollen Hunderte Straßen für Autos dichtmachen